Meine Identität als TransaktionsanalytikerIn Faszination und Konfliktfeld
|
|
|
- Oswalda Kästner
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Ingo Rath (2008) Meine Identität als TransaktionsanalytikerIn Faszination und Konfliktfeld Veranstaltung von Matthias Sell und Ingo Rath am DGTA Kongress in Schwerin 2008 Dies ist eine erweiterte schriftliche Fassung des Beitrages von Ingo Rath mit den Themen 1 : 1. Identität als Spannungsfeld zwischen Selbstobjektivierung und gesetzlichem Anspruch a) Die Identität als TransaktionsanalytikerIn im Kontrast b) Begriffliche Grundannahmen zur Identität c) Zum Nachweis der Identität als TransaktionsanalytikerIn 2. Inhalte der Identität Zur Professio der TA a) Meine subjektive transaktionsanalytische Professio b) Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen Was fasziniert mich, was ist zu metabolisieren? c) Was bleibt von Eric Berne? Was könnte zum gemeinsamen, übergeordneten Gut der Transaktionsanalyse gehören? 1. Identität als Spannungsfeld zwischen Selbstobjektivierung und gesetzlichem (gesellschaftlichem) Anspruch a) Die Identität als TransaktionsanalytikerIn im Kontrast Beginnen wir mit zwei Kontrasten die Identität als Transaktionsanalytikerin betreffend: Den professionellen Auftrag und Die gesetzliche Anerkennung der Profession Da im Allgemeinen eine berufliche Identität mit einem professionellen meist gesetzlich verankerten Auftrag verbunden ist, steht die therapeutische Identität als Transaktionsanalytiker allein schon dadurch im Kontrast zu den Identitäten als Berater, Pädagoge oder Organisationsentwickler. Dies zieht Unterschiedlichkeiten in der Identität und der Organisation der Ausbildung nach sich. Der professionelle (meist auch gesetzlich verankerte) Auftrag für die transaktionsanalytische Psychotherapie hier geht es kurz gesagt um die Milderung und Heilung von psychischen Leidenszuständen - liegt implizit in der transaktionsanalytischen Theorie begründet und leitet sich davon ab. Im Unterschied dazu liegt der professionelle Auftrag für die Anwendungsbereiche außerhalb der Transaktionsanalyse begründet und wird von diesen Bereichen her bestimmt. In 1 Es ist geplant, den Beitrag von Matthias Sell ebenfalls zu verschriftlichen und dann beide Beiträge zu verbinden. 1
2 diesen Fällen stellt sich eher die Frage, was die Transaktionsanalyse zur Identität als Berater, Pädagoge und Organisationsentwickler beitragen kann Einen weiteren Kontrast ergibt sich aus dem Umstand, dass die Transaktionsanalyse in Ländern als wissenschaftliche psychotherapeutische Methode gesetzlich anerkannt ist und in Ländern, wo dies (noch) nicht der Fall ist. Das hat einen bedeutsamen Einfluss auf die Identität. In Österreich hat beispielsweise die gesetzliche Anerkennung 1. einerseits zu einer Modifizierung theoretischer und therapiepraktischer Konzepte geführt, 2. andererseits eine Umorganisation der Ausbildung notwendig gemacht, weil die staatliche Anerkennung die Eigenverantwortlichkeit der Ausbildungseinrichtung erforderte und als Rechtsträger der Ausbildung diese auch für deren Qualität haftbar macht. 3. Weiters sind die unterschiedlichen anerkannten Schulen im so genannten Psychotherapiebeirat vertreten und in verschiedenen Ausschüssen vernetzt, in denen die fachspezifischen Abschlüsse überprüft und die Ausübung der Profession als PsychotherapeutIn: Transaktionsanalytische Psychotherapie beschlossen wird, in denen Ethikrichtlinien, Richtlinien für Lehrtherapeuten, für Lehrsupervisionen usw. erarbeitet werden, die vom Gesundheitsministerium dann erlassen werden. Hier ist ein TA-spezifisches Konfliktfeld anzusprechen, weil international gesehen, die anderen therapeutischen Richtungen eine unterschiedliche eher partnerschaftliche Organisationsform aufweisen, die die Eigenständigkeit der nationalen Vereinigungen nicht antastet. Dies hat in Österreich maßgeblich auf die Identität Einfluss genommen, denn Diener zweier Herren zu sein, erzeugt ein oftmals bis zum Zerreißen reichendes Spannungsfeld. Allerdings hat dies auch zu einer Klärung und Festigung der Identität des Österreichischen Arbeitskreises für tiefenpsychologische Transaktionsanalyse und deren Mitglieder geführt. Ein paar Worte zur Modifizierung von Theorie- und Praxiskonzepten: Hier haben wir (der Österreichische Arbeitskreis für Tiefenpsychologische Transaktionsanalyse ÖATA) versucht, die unterschiedlichen Konzepte auf eine gemeinsame Grundlage zu stellen und sie so weit wie möglich zu vernetzen. Drei Aspekte, die ich später noch genauer ausführen werde, seien hier erwähnt: 1. Die Enthistorisierung der Berneschen Theorie wird aufgehoben, die psychoanalytischen Wurzeln wieder einbezogen und in die Theorie und Praxis integriert, d.h. die bioanalytische Bestimmtheit die triebhaften Wurzeln - des Menschen (Berne hatte eine psychoanalytische Ausbildung) und seine psychosoziale Bestimmtheit (Berne war Sozialpsychiater) sind nicht trennbar und bilden eine differenzierte Einheit. 2. Den transaktionalen Austausch, d.h. das Beziehungsgeschehen zwischen zwei Menschen der Theorie und Praxis zugrunde zu legen und nicht so sehr die Ichzustandsmodelle. Damit wird den Prozessen mehr Gewicht als deren Ergebnissen beigemessen. 3. Die frühe Bernesche Sichtweise des Menschen als Organismus, als Ganzheit, wird aufgegriffen und zum Konzept eines psychodynamisch holistischen Systems (Organismus) erweitert. Ein solches System besitzt eine implizite Ordnung und eine daraus entfaltete explizite Ordnung. Dieses gewichtet, 2
3 bewertet, verarbeitet und speichert Daten und Erfahrungen und stellt sie für zukünftige Situationen wieder zur Verfügung. b) Begriffliche Grundannahmen zur Identität Subjektivität und transaktionales Geschehen Identität und Identifizieren Subjektivität ist die persönliche Eigenart und Voreingenommenheit (lat.: subicere = zugrunde liegen), die in der Beziehung zum Du, zu einem Gegenüber erlebt wird. Subjektivität ist die Bewusstheit meiner selbst in der Beziehung zu einem anderen oder einem inneren Objekt (Konzepte, Techniken). Subjektivität entwickelt sich nur in Beziehung zu anderen, für sich allein gibt sie keinen Sinn. Die Subjektivität hat somit eine historische Dimension. Eine Enthistorisierung bedeutet daher immer auch eine Entsubjektivierung. Nicht nur das Erleben im Hier und jetzt ist daher therapeutisch von Bedeutung, sondern auch die Genese der Beziehungsmuster. Eine Bemerkung zum transaktionalen Geschehen, der für mich ein zentrales Identität stiftendes Konzept der Transaktionsanalyse darstellt und zu meiner transaktionsanalytischen Professio gehört. Das transaktionale Geschehen wird nach Berne durch den transaktionalen Austausch bestimmt und beschrieben. Ich weiß, dass Menschen, wenn sie miteinender reden, etwas austauschen, und das ist der Grund dafür, warum Menschen miteinander reden. (Berne 1984, S 8). Dieser Hypothese schließen wir uns hier an. Der transaktionale Austausch (Abb.1) gestaltet das wechselseitig sich organisierende und regulierende Beziehungsgeschehen zwischen zwei Menschen. Das interaktive Zusammenspiel von Reaktion und Re-Reaktion in Verbindung mit den Prozessen der Internalisierung und Externalisierung strukturiert und gestaltet die innere und äußere Welt. Die Selbstobjektivierung ist, wie die anschließend thematisierte Identifizierung, eine spezifische Form des Austausches, bei dem das Selbst oder ein Teil davon nach außen gelegt wird, und sich in den Werken der Künstler, in den Romanen der Schriftsteller, in den Theorien der Wissenschafter, in der Beziehungsgestaltung der Therapeuten usw. manifestiert. Die Beziehung zwischen zwei Menschen wird als die kleinste psychosoziale Einheit und Ganzheit betrachtet, die im transaktionalen Austausch reguliert und organisiert wird (siehe Rath 1996, 2007 a, b) Abb. 1 Abb. 2 Das Beziehungsgeschehen bildet eine untrennbare Einheit, das von jedem Interaktionspartner je nach seiner Differenzierungsfähigkeit zwischen Selbst (S) und Nichtselbst wahrgenommen, verarbeitet und in der inneren Welt (IW) gespeichert 3
4 wird (Abb. 2). Wird die Internalisierung in die innere Struktur integriert, so wird sie zur Wesenseinheit und als persönliche Eigenart erlebt. Subjektion und Objektion gestalten das Zusammenspiel zwischen der erlebenden und der repräsentationalen Welt. Ein harmonisches Zusammenspiel kennzeichnet erlebende Beziehungen. Wird die Internalisierung nicht integriert, kommt es nur zu deren Anlagerung, steht in einer Beziehung nur funktional zur Verfügung und ist möglicherweise nicht mit dem Selbst verbunden ist, d.h. in der Objektion fixiert. In der Ausbildung sind daher Möglichkeiten zur Metabolisierung 2 der Theorie zu eröffnen, d.h. aufnehmen, verdauen, Brauchbares annehmen und integrieren, und Unbrauchbares ausscheiden. In diesem Zusammenhang ist die Frage berechtigt, in wie weit in der Ausbildung eine Integration von Theorie und Praxis gefördert wird, die zu einer subjektiven transaktionsanalytische Identität führt, oder, was deren Hemmung begünstigt. Identität und Identifizieren Identität leitet sich etymologisch aus dem lateinischen Demonstrativpronomen Idem (ein durch em verstärktes id ) ab, übersetzt eben das ein und dasselbe und bedeutet: vollkommene Übereinstimmung, Wesenseinheit (körperliche, seelische und geistige) Ganzheit. Identität zeigt sich in der Subjektivität innerhalb eines gemeinsamen transaktionsanalytischen Bezugsrahmens. Es dürfte darin Übereinstimmung bestehen, dass der transaktionale Austausch zwischen Personen und deren Reaktionen als erlebbare Ichzustände zur Wesenseinheit der Transaktionsanalyse gehört. Für die subjektive Ausgestaltung sollte sich in der transaktionsanalytischen Gesellschaft ein akzeptierter Toleranzrahmen entwickeln können, der natürlich eng oder weiter gefasst sein kann. Identität ist der Ausdruck der subjektiven Differenziertheit in der Ganzheit. In einem transaktionsanalytischen Bezugsrahmen können nun folgende Identitäten unterschieden werden, die sich allerdings wechselseitig bedingen: Die subjektive Identität als transaktionsanalytischer Psychotherapeut, die Identität einer Ausbildungseinrichtung innerhalb der Transaktionsanalyse, die Identität der transaktionsanalytischen Psychotherapie innerhalb der Gesamtheit der psychotherapeutischen Heilverfahren, die Identität der Psychotherapie innerhalb der gesetzlichen Ordnungen der Gesellschaft (eines Staates). Konfliktfelder ergeben sich aller Orten, denn eine subjektive Ausgestaltung der Identität findet zwangsläufig im Spannungsfeld der Ausdifferenzierung innerhalb einer Ganzheit statt, psychoanalytisch ausgedrückt, in der Bewältigung des Ödipuskonfliktes, der mit einer Einordnung in eine gesellschaftliche Ganzheit zusammenhängt. Es geht hier um Einordnung nicht um Unterordnung in ein Gemeinsames, was bekanntlich eine Überanpassung darstellen würde. 2 Metabolie bedeutet Umwandlung, Veränderung durch Stoffwechsel (in der Biologie). Metabolisieren wird auch im übertragenen Sinn bei psychischen und geistigen Prozessen im Sinne von Aufnehmen, Verarbeiten, Brauchbares behalten und Unbrauchbares ausscheiden verwendet. 4
5 Identifizieren setzt sich aus dem Lateinischen idem und facere zusammen, übersetzt: daraus ein und dasselbe machen. Sich identifizieren bedeutet, sich auf einen Prozess einzulassen, das zu Identifizierende, das Idemfacandum (das, was zur Wesenseinheit gemacht werden soll), anzunehmen und sich damit subjektiv auseinanderzusetzen mit dem vorläufigen Ergebnis, dass das Selbst mit dem Idemfactum (das, was zur Identität gemacht wurde) eine Wesenseinheit bildet. Identität ist daher nichts Feststehendes, sie ist einem laufenden Prozess ausgesetzt, auch mitbestimmt durch ein sich modifizierendes Idemfacandum (das, was ident gemacht werden soll). Nebenbei erwähnt, bezeichnet Freud die Identifikation als die früheste Äußerung eine Gefühlsbindung an eine andere Person, die dazu strebt, das eigene Ich ähnlich der Person (oder einem Anteil davon) zu gestalten, die eine Faszination ausübt. Faszination selbst sieht Freud zwischen Verliebtheit und Hypnose angesiedelt. Faszination ist in Liebe zu verwandeln, allerdings nicht zu einer bedingungslosen. Subjektives Erleben in Beziehungen und Identifizieren sind die beiden Prozesse, die zur Wesenseinheit, zur Identität führen. In der Wesenseinheit sind Selbst und Internalisierung integriert. Die Selbstobjektivierung dieser Wesenseinheit gestaltet die therapeutische Beziehung mit und stellt den bedeutsamsten Faktor für Veränderungsprozesse dar. c) Zum Nachweis der Identität als TransaktionsanalytikerIn Gehen wir von einem unverfänglichen Beispiel aus:. In Österreich gab es nach dem 2. Weltkrieg den so genannten Identitätsausweis, der die Identität einer Person durch den Besitz eines solchen Dokumentes belegt. Er enthielt neben persönlichen Daten ein Lichtbild und weitere spezifische Merkmale die Person betreffend, um die Identität, die Übereinstimmung der Person mit dem Dokument feststellen zu können. Heute dienen Fingerabdrücke, der DNS-Abdruck, die Irisstruktur usw. der Erkennung. Dabei geht es um ein Merkmal, das allen Menschen gehört und das durch individuelle Ausgestaltungen eine subjektive Unterscheidbarkeit zulässt. Mit diesem Beispiel will ich illustrieren, dass Identität ein Konstrukt von Merkmalen darstellt, die sich subjektiv verschieden entwickeln und ausgestalten, aber eine übergeordnete Gemeinsamkeit erhalten, wie es z.b. das Konzept des transaktionalen Austausches. Wenden wir uns den Identitätsausweisen zu, die die berufliche Qualifikation, d.h. die Wesenseinheit der Person mit seiner Profession, dem Idemfacandum (das, was ident gemacht werden soll), bezeugt und bestätigt, dass die Person dazu befähigt ist, den professionellen meist gesetzlich festgelegten Auftrag zu erfüllen. Solche Identitätsausweise heißen Gesellenbriefe, Meisterbriefe, Diplome, Zertifikate, Urkunden aller Art und anderes. In Österreich gilt der Bescheid des Gesundheitsministeriums als PsychotherapeutIn mit der Zusatzbezeichnung Transaktionsanalytische Psychotherapie in die Psychotherapeutenliste des Bundeskanzlers aufgenommen zu sein als Identitätsausweis. In anderen Ländern stellt die EATA ein Abschlusszertifikat aus, das allerdings nicht gesetzlich anerkannt ist. Das 5
6 Abschlusszertifikat stellt sozusagen den Identitätsausweis dar, der den Vollzug der Wesenseinheit der Person mit dem Idemfacandum (das, was ident gemacht werden soll) Vorstellungsbild Transaktionsanalytische Psychotherapeutin bestätigt. Wird das Idemfacandum - meist als Curriculum dargestellt - und die Ausbildung danach gesetzlich anerkannt, erhält es das Attribut der Professionalität. Profession leitet sich von professio ab, d.h. übersetzt: ein öffentliches Bekenntnis, ein Gelübde ablegen, und in der Folge im öffentlichen Dienst oder beim Heer einen Eid auf die Verfassung ablegen, die Zugehörigkeit zu einem Gewerbe öffentlich bekennen usw. Der Bekennende identifiziert sich mit dem Glaubensbekenntnis, den Regeln und Gesetzen der Gemeinschaft und bekennt, es zum idemfactum (das, was zur Identität gemacht wurde) gemacht zu haben. Nur in diesem Sinne kann von Professionalität gesprochen werden. Nur wer diese gesetzlich beurkundete Profession öffentlich kund gemacht hat, darf den Beruf mit dem festgeschriebenen professionellen Auftrag ausüben. Alles andere wird - zumindest in Österreich - als Pfuscherei bezeichnet, was nicht heißt, dass es nicht gut und hilfreich sein kann. Die öffentlich be(ur)kundete Professio ermöglicht den Patienten und Patientinnen eine gewisse Orientierung der professionellen Handlungskompetenz eines Mitgliedes einer psychotherapeutischen Richtung. 2. Inhalte der Identität Zur Professio der TA a) Meine (Ingo Rath) subjektive transaktionsanalytische Professio illustriert an Hand von vier ausgewählten Identität stiftenden Konzepte: (1) Das transaktionale Geschehen sehe ich als ein übergeordnetes Konzept der Transaktionsanalyse an. Hier verweise ich auf die Darstellungen des Themas in dieser und in den früheren Arbeiten (Rath 2007a,b,c,d,e). (2) Die therapeutische Begegnung mit meinen Gegenübertragungsreaktionen und der Reflexion des Geschehens. Zu theoretischen Fragen verweise ich auf Rath (2007c,d), im therapeutischen Setting stelle ich mir folgende Fragen: Wie erlebe ich die Beziehung zum Gegenüber? Was löst sie in mir aus? (Gegenübertragungsreaktion) Wie gestaltet das Gegenüber die Beziehung? Was macht er/sie mit mir? Ich mit ihr/ihm? Ist das angemessen oder unangemessen (als Frage nach problematischen Beziehungsmustern)? Was ist die Not, das Problem des Patienten? Was hat das alles auch mit mir zu tun? (3) Konzept des Inneren Kindes und der Inneren Eltern. Zum diesem Konzept verweise ich auf die Darstellung in Rath (2008) und führe hier beispielhaft prozessleitende Fragestellungen an in Bezug zum idealtypischen und realtypischen Aspekt des Inneren Kindes und zum elterlichen Einfluss: Welches Ich-Bild vom kleinern Buben usw. in einer problematischen Beziehungssituation entsteht in mir? Wie schaut die Abwehr und Widerstand des Inneren Kindes des Patienten aus? Wo liegen seine Ressourcen? 6
7 Wo sind die phasenspezifischen Fixierungen und Introjektionen bezogen auf die gespeicherten Erfahrungen im Ichsystem? Weiters, welche Skriptleitlinien, werden sichtbar, welche Glaubenssätze gibt es? Wie fügt sich die therapeutische Szene in das Skript von mir und ihm/ihr in den bisherigen Verlauf ein? Wie ist die Szene zu verstehen? (4) Das Konzept des Zusammenspiels von Abstinenz und Beelterung Das Zusammenspiel von Abstinenz und Beelterung wurde als Abstinenzregel von den Mitgliedern des ÖATA auf einem gemeinsamen Seminar zur Entwicklung der Identität als TransaktionsanalytikerIn erarbeitet. Die Abstinenzregel bedeutet maßvolle Versagung und maßvolle Befriedigung in Bezug auf eine entwicklungspsychologische phasenspezifische Situation mit dem Ziel der Entwicklung des Patienten. Befriedigung und Versagung sind dabei in einer zurückhaltenden und wohlgesinnten Haltung eingebettet. Die Abstinenzregel als therapeutische Leitlinie kurz formuliert: Versagung so weit wie möglich Befriedigung so weit wie nötig Diese Abstinenzregel ist in Verbindung mit den drei Berneschen Grundbedürfnissen: Stimulierung, Zuwendung, Struktur (innere und äußere) und mit verschiedenen, aber modifizierten Techniken der TA z.b. Elterninterview nach McNeel, Innere Kindarbeit, Analyse und Reflexion des Beziehungsgeschehens zwischen Therapeut und Patientin (Übertragung und Gegenübertragungsanalyse Beziehungsanalyse usw.) zu sehen. b) Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen Was fasziniert mich, was ist zu metabolisieren? Eric Berne als Begründer der Transaktionsanalyse Eric Berne hat mit seinem subjektiven Skript natürlich einen wesentlichen Einfluss auf die Theorie und Praxis der Transakationsanalyse und ihre Tradition. Denn, was immer jemand schreibt, es ist als Selbstobjektivierung zu verstehen, bei der die Innenwelt, das Skript einen Ausdruck in der Außenwelt findet. Das bedeutet, dass neben seinen kreativen Ansätzen auch problematische Anteile Bernes Persönlichkeit in die Wesenselemente der Transaktionsanlyse einfließen. Diese sind aus heutigem Wissensstand heraus aufzuspüren und zu metabolisieren. In die Persönlichkeit von Eric Berne kann man durch ein intensives Studium seiner Schriften Einblick gewinnen, insbesondere seiner frühen vor dem Jahr 1956 verfassten, dem Jahr der Ablehnung seines Aufnahmeansuchens in die psychoanalytische Gesellschaft. Die Polaritäten Unabhängigkeit - Abhängigkeit, Freiheit - Bestimmtheit, Ganzheitlichkeit Fragmentierung, Nähe Distanz (Liebe) mit Selbstbewahrung und Hingabe, Autarkie und Selbstlosigkeit, u.a. durchziehen die Begrifflichkeit in seinen Konzepten. Bernes Transaktionsanalyse hat daher nicht ohne Grund ihre Stärken in der Theorie und Behandlung von Frühstörungen, in der Freudschen Entwicklungspsychologie gesprochen, in den Bereichen, in denen die Oralität und Analität eine bedeutende Rolle spielen. Dies findet auch in ihren 7
8 Begriffen und Konzepten ihren Niederschlag, man denke beispielsweise an Symbiose, Ausbeutungstransaktionen, (Macht)spiele, OK-Positionen, gekreuzte Transaktionen usw. Eine der Schwächen der Transaktionsanalyse liegt darin, dass Berne kein Konzept entwickelte, das dem Freudschen Über-Ich als Ausdruck des Gewissens entspricht. Das Bernsche Konzept des Eltern-Ichs können als Vorläufer des Über-Ichs angesehen werden. Auch die Strukturierung des Erwachsenen-Ichs durch Ethos, Logos und Pathos löst das angesprochene Problem nicht, denn das entspräche einem fragmentierten Über-Ich (Gewissen). Als Transaktionsanalytiker müssen wir zu zugestehen, dass die Theorie von Berne die ödipale Ebene (noch) nicht erreicht hat. Manche Bernsche Textstellen können einen durch sein Einfühlungsvermögen gefangen nehmen, wie beispielsweise in der Beschreibung der Familie Brschiss im Abschnitt Wie reagiert das Kind auf das Verhalten seiner Eltern? (Berne 1970, S. 110 ff) 3. Es ist sehr berührend, wie sich Berne in die Denkweise eines kleinen Kindes einfühlen kann und das Erleben aus der Sicht dieses Kindes schildert. In anderen Textstellen wiederum finden sich Ungereimtheiten und Widersprüchlichkeiten, wie beim Strukturmodell der Ichzustände, insbesondere dort, wo sich ein Zusammenhang zur Abwehr seiner Kränkung erahnen lässt. So kommt beispielsweise in der Konzeptualisierung der drei Grundbedürfnisse, dem Hunger nach Stimulierung, dem Hunger nach Liebe und Zuwendung und dem Hunger nach (innerer und äußerer) Struktur seine differenzierte Intellektualität zum Ausdruck. Dies kann auch als Selbstheilungsversuch der behindernden schizoid-depressiven Anteile seiner Persönlichkeit gesehen werden. Berne ist allzu früh mit sechzig Jahren an gebrochenem Herzen gestorben. Um Eric Berne gerecht zu werden, ist folgendes zu bedenken: In der Zeit zwischen der ersten Definition der Ichzustände im Jahre 1957 bis zu Bernes Tod 1970 liegt eine Spanne von 13 Jahren, ein geringer Zeitraum, der ihm zur Entwicklung der Transaktionsanalyse geblieben ist. Man könnte sagen, seine Transaktionsanalyse stellt als Erbe ein Palimpsest dar, in dem seine zahlreichen Ideen Konzepte enthalten sind, die naturgemäß mit Ungereimtheiten und Widersprüchlichkeiten kontaminiert sind und von ihm nicht (mehr) zu einer konsistenten Theorienlandkarte ausgearbeitet werden konnten. Daher sehe ich es als sein Testament an, seine genuinen Ansätze und Konzepte zu würdigen, zu metabolisieren und weiter zu entwickeln (Rath 2008). Weiters möchte ich einige würdigende und kritische Aspekte zur Berneschen Transaktionsanalyse anbringen, die bei deren Metabiliserung zu bedenken sind: (1) Berne hatte bis zum Zeitpunkt der Ablehnung seiner Aufnahme in die psychoanalytische Gemeinschaft ein eher ganzheitliches Wissenschaftsverständnis, zumindest implizit. Dies wird in seinen frühen Arbeiten (Berne 1991) deutlich, die sich mit Intuition, Übertragungs- und Gegenübertragungsreaktionen (Diagnose, Ich- Bilder), Kommunikation und Urbilder beschäftigen, in denen ein übergeordnetes holistisches (ganzheitliches) Ordnungsprinzip erkennbar ist, das bereits Heisenberg in der Physik formuliert hat und als Heisenbergsche Unschärferelation bekannt wurde. Sie besagt, etwas laienhaft ausgedrückt, dass Ort und Zeit (der Impuls) eines Elementarteilchens nicht exakt bestimmbar sind, eine Unschärfe (Unbestimmbarkeit) 3 Erstmals erschienen 1947 unter dem Titel The Mind in Action und dann 1957 wieder aufgelegt unter dem Titel A Layman s Guide to Psychiatry and Psychoanalysis 8
9 bestehen bleibt, d.h. hat man den genauen Ort, so kennt man den Zeitpunkt nicht genau, wann es sich an diesem Ort befindet, lässt sich der Zeitpunkt genau bestimmen, ist der Ort nur vage bestimmbar. Wichtig sind für uns die erkenntnistheoretische Folgerung, die über den physikalischen Rahmen hinausgeht: Beobachter und beobachtetes Objekt sind nicht strikte trennbar, es besteht zwischen beiden eine Verbindung, die die physikalische Messung (bei Personen die wechselseitige Wahrnehmung) beeinflusst. Die Unmöglichkeit einer strikten Trennung von Subjekt und Objekt bedeutet in menschlichen Beziehungen weiters, dass es grundsätzlich keine Hierarchie zwischen den Interaktionspartnern gibt und trotz Unterschiedlichkeit eine Verbindung innerhalb eines übergeordneten Prinzips besteht, das noch schwer fassbar und beschreibbar ist. Für Berne war es in seiner Arbeit ein wichtiges Anliegen, die Hierarchie zwischen Psychiater und Patient aufzuheben (daher auch seine vereinfachende Fachsprache, die allerdings später zum Nachteil der Transaktionsanalyse ausgelegt wurde) und die Patienten in die Besprechungen einzubeziehen, damit sie ihre Verantwortung für die Gesundung wahrnehmen können. Heilung wird für Eric Berne zum gemeinsamen Anliegen, sie unterliegt einem übergeordneten Prinzip, das die nicht strikte Subjekt- Objekt Trennung beinhaltet. Berne drückt diesen Sachverhalt noch verschlüsselt beispielsweise durch Eine präzise Botschaft ist psychologisch undenkbar (Berne 1953, 1991,S. 87) aus. Das bedeutet mit anderen Worten, dass eine manifeste (bewusste) Botschaft nicht strikt von einer latenten (unbewussten) Botschaft trennbar ist. Differenzierung ist möglich, eine strikte Trennung allerdings nicht. Für die Kommunikation zwischen zwei Menschen bedeutet dies, dass nicht strikt zwischen Sender (dem Subjekt) und Empfänger (dem Objekt) unterschieden werden kann,und, dass die Reaktionen der Kommunikationspartner einem gemeinsamen übergeordneten Prinzip gehorchen. Berne sieht Beziehung als psychosoziale Einheit an und entwickelt die Transaktionsanalyse zunächst als Zweipersonenpsychologie, die er später im Strukturmodell der Ichzustände zu einer Ichpsychologie reduziert und die strikte Subjekt-Objekt-Trennung allerdings wieder aufhebt (Rath 2007a,b). (2) Ganz im Sinne von Paul Federn postuliert Eric Berne zwei Energiequellen der menschlichen Psyche. Neben der bioanalytischen grundgelegten Energie des ES nimmt er eine psychosozial erzeugte Ich-Energie an, die im transaktionalen Geschehen zwischen Menschen durch die drei Grundbedürfnisse, dem Hunger nach Stimulierung, nach Zuwendung und nach Struktur, generiert wird. Berne entwickelte die Transaktionsanalyse (ursprünglich The Theory oft Mind genannt) sowohl auf triebdynamischen als auch auf phänomenologischem Hintergrund. Dies ist auch aus der Definition der Urbilder ableitbar, in der der triebdynamische mit dem beziehungsdynamischen Aspekt verbunden ist. Nach 1956 grenzt sich Berne stärker von der Psychoanalyse ab und stellt die vorbewussten und bewussten Anteile der Psyche, die phänomenologisch beschreibbar sind, in den Mittelpunkt seiner Theorie, kommt aber gegen Ende seines Lebens wieder auf den Anfang zurück. In Was sagen Sie, nachdem Sie guten Tag gesagt haben ist der triebdynamische Aspekt implizit wieder enthalten. Ohne psychoanalytischen Hintergrund ist Bernes Hallo- Buch nur schwer verständlicher. In einer Zeit, in der die Forschungen der Neurobiologie die Psychotherapie zu überschwemmen drohen, möchte ich auf zwei Dinge hinweisen, auch wenn ich dadurch Eulen nach Athen trage. Neurale und mentale Zustände sind nicht identisch, können aber als Entfaltungen einer höheren Ordnung eines holistischen Systems 9
10 betrachtet werden. Weiters ist Ordnung nicht identisch mit einem Entwicklungsplan, der einer deterministischen Sichtweise der Welt zugrunde liegt. Das subjektive Bewusstsein ist zwar an biologische Prozesse gebunden und entwickelt sich als Selbstbewusstsein innerhalb eines holistischen Systems (Zweierbeziehung, Gesellschaft) und kann weiters zu einer sozialen interpersonalen Intelligenz transformiert werden. (3) Eine von Bernes Grundideen ist die Erweiterung von Gedanken-., Entscheidungs- und Handlungsspielräumen d.h. nicht die Freiheit von etwas, denn Autonomie ist relativ und eingebettet in einen sozialen Bezugsrahmen. Denn Anpassung an einen sozialen Rahmen schafft erst Alternativen und damit Freiräume. Allerdings ist zu beachten, dass der Mensch durch die Wahrnehmung von Alternativen (bzw. eines DU als Gegenüber) sich einem Gegenüber schuldig machen und Scham empfinden kann, weil er unterschiedlich denkt, fühlt und handeln kann. Je mehr Bewusstheit der Mensch erlangt, desto mehr ist er den Gefühlen von Schuld und Scham ausgesetzt. Weiters ist festzuhalten, dass aus Bernes Skripttheorie nicht abgeleitet werden kann, dass die Vergangenheit die Gegenwart (ganz) determiniert und die Zukunft folglich auch nicht determiniert vorausgesagt werden kann. Das Erleben und Handeln im Hier und Jetzt wird nach Berne bestimmt durch - exteropsychische Einflüsse - archeopsychische Einflüsse (inklusive der Natur des Menschen) - neopsychische Einflüsse (Subjektivität des Gegenüber, Kontext, in dem das Beziehungsgeschehen sich gestaltet) - ein übergeordnetes Prinzip, das Berne mit Spontaneität, Kreativität und Intimität umschreibt und als psychosoziale Intelligenz bezeichnet werden könnte. Zur Metabolisierung der Berneschen Theorie wurden an anderer Stelle bereits Vorschläge gemacht (Rath 1992, 2007a,b,c,d,e, 2008), insbesondere zum transaktionalen Austausch, zu den Ichzuständen, zum Ichsystem als Strukturmodell und zum Konzept en des Inneren Kindes und der Inneren Eltern vorgelegt. Ich halte hier wesentliche Punkte fest: 1. Ichzustände gestalten sich ursächlich als phänomenologische Reaktionen der Interaktionspartner im transaktionalen Geschehen mit manifesten und latenten Anteilen und stellen eine Momentaufnahme im Erleben mit damit verbundenen Handlungsmöglichkeiten dar, 2. Ein Ichzustand ist kein strukturbildendes Element der Psyche, erst die innerpsychische Verarbeitung eines Ichzustandes erzeugt einen seelischen Abdruck, der strukturbildend ist. 3. Die Ichzustände werden teilt Berne ein: In der Realität angemessene neopsychische Ichzustände und in der Realität unangemessene (pathologische) Ichzustände, diese weiters je nach ihrer Herkunft in archeopsychische oder exteropsychische Ichzustände, bzw. Kind-Ichzustände bzw. Eltern-Ichzustände. 4. Das Ichsystem, bestehend aus Archeopsyche, Exteropsyche und Neopsyche wird als Strukturmodell der Transaktionsanalyse angesehen. Die Archepsyche ist der Speicher (das Gedächtnis) für die eigenen verarbeiteten Erfahrungen, die Exteropsyche der für die übernommenen Beziehungsmuster und Informationen, und die Neopsyche ist ein System von Funktionen, das auf die 10
11 Verarbeitung und Speicherung des Erlebens und die Entscheidungen zum Handeln zuständig ist. 5. Zwischen einem Ichzustand als Reaktion im transaktionalen Geschehen und einer Ich-Gestalt (z.b. Kind-Ich oder Inneres Kind) als intrapsychische Struktur ist zu unterscheiden, weil sie unterschiedliche Abstraktionskategorien darstellen und deren Vermischung zwangsläufig zu logischen Widersprüchen führt. Das Innere Kind und die Inneren Eltern (Vater, Mutter) sind jene strukturellen Ich-Gestalten, die einen bedeutsamen intrapsychischen Einfluss auf eine Person im transaktionalen Geschehen ausüben. Diese Ich-Gestalten sind als Subsystem des Ichsystems zu verstehen und nicht dem K-Ich und EL- Ich des Bernschen Strukturmodells der Ichzustände identisch. c) Was bleibt von Eric Berne? Was könnte zum gemeinsamen, übergeordneten Gut der Transaktionsanalyse gehören? Diese Fragen können nur im transaktionalen Austausch innerhalb der Gemeinschaft der TransaktionsanalytikerInnen beantwortet werden. Dennoch will ich zwei grundlegende Konzepte der Transaktionsanalyse als Beispiele anführen und darlegen, die aus meiner Sicht zum identitätsstiftenden Gut der Transaktionsanalyse gehören. 1. Das Bernsche Trübungskonzept der Ichzustände Das Trübungskonzept und die Enttrübungsarbeit nach E. Berne habe ich ausführlich und kritisch gewürdigt (Rath 2008). Seine Strukturanalytische Darstellung einer doppelt getrübten Persönlichkeit (Berne 1957b, 1991 S.160) wird als topographisches Modell der Ichzustände metabolisiert kurz zusammengefasst dargestellt. Abb. 3 Topografisches Modell der Ichzustände Das topographische Modell (Abb. 3) ist als phänomenologischer Ausdruck der impliziten Ordnung der Psyche (Rath 2007) zu verstehen und geht von der Idee des integrierten Erwachsenen Ichs (James 1977) aus. Damit werden die angemessenen Erwachsenen-Ichzustände im Mittelpunkt des therapeutischen Handelns gestellt, die durch die archeopsychischen und exteropsychischen Ichzustände (pathologischen Kind- und Eltern-Ichzustände) im transaktionalen Geschehen kontaminiert werden können. Weiters trägt es dem Umstand Rechnung, dass eine strikte Trennung im Erleben zwischen den angemessenen Erwachsenen-Ichzuständen und den archeopsychisch und exteropsychisch kontaminierten Ichzuständen nicht möglich ist und drittens beinhaltet es die topographische Nähe bzw. Ferne zu den bewussten der Realität angemessenen Ichzuständen. Die von schwarz bis weiß schattierten Kreise der archeopsychischen und exteropsychischen Ichzustände drücken die Nähe bzw. Ferne zu den angemessenen Er-Ichzuständen aus. 11
12 Die Darstellung der Abb. 3 ist eine zweidimensionale Vorstellungshilfe und daher eine Reduktion der Komplexität. Da es natürlich auch keine strikte Trennung zwischen den pathologischen Kind-Ich- und Eltern-Ichzuständen gibt, ist diese Überlappung räumlich vorzustellen, indem die Abb. 3 zu einer Schleife verbunden wird. In diesem entstehenden gemeinsamen schwarzen Bereich sind beispielsweise jene Ichzustände zu lokalisieren, die dem Inneren Dämon entspringen, die sowohl archeopsychischen als auch exteropsychischen Ursprunges sind und die der Bewusstheit am Fernsten liegen. Die grau schattierten Überlappungen der Kreise in Abb. 3 illustrieren Ichzustände mit als ob -Charakter verbunden mit Krankheitseinsicht. Die Überlappung kennzeichnet jenen Bereich, der von zwei widersprüchlichen Ichzuständen, dem Erwachsenen- Ichzustand und dem pathologischen Kind-Ichzustand, bzw. Eltern-Ichzustand besetzt ist und von einer Person ich-dyston erlebt wird. Manchmal ist mir, als wäre ich eigentlich kein Rechtsanwalt, ich bin nur ein kleiner Junge (Berne 1957a, 1991 S 131). Dem Patienten in dieser Geschichte ist bewusst, dass er sich in bestimmten Situationen unterschiedlich erlebt, einmal der Situation angemessen als Erwachsener, ein andermal der Situation unangemessen wie ein kleiner Junge. Der Patient kann die beiden Ichzustände unterscheiden, er erlebt und handelt, als ob er noch ein kleiner Junge wäre. Ein Als ob Zustand des Erlebens ist dadurch gekennzeichnet, dass das unterschiedliche Erleben bewusst ist und der Realitätskontrolle der erwachsenen Person zugänglich ist, dass aber die Widersprüchlichkeit noch nicht aufgelöst ist und in deren Persönlichkeit integriert ist. Therapeutisch geht es dann um die Integration des pathologischen Anteils in die Gesamtpersönlichkeit, nicht um eine Differenzierung des Erlebens. Wenn der Einfluss archeopsychischer bzw. exteropsychischer Relikte aus der Kindheit vom Patienten als ich-synton erlebt wird, also dem Erwachsenen-Ich noch ferne steht, spricht Berne ([1957b], 1991) von einer Trübung des Erwachsenen durch das Kind-Ich bzw. Eltern-Ich. Dieser Einfluss wird vom Patienten als ich-synton erlebt und ist daher der Bewusstheit ferner als die Zustände mit als ob -Charakter. Die entsprechenden Ichzustände liegen außerhalb des gedachten ER-Kreises 4. Nur diese entsprechen den kontaminierten (getrübten) Ichzuständen, wie Berne sie definiert hat. Die Enttrübungsarbeit nach Berne dient dazu, die pathologischen Einflüsse bewusst werden zu lassen, also ich-dyston werden zu lassen und zwischen dem unangemessenen Ichzustand und einem bereits vorhandenen angemessenen oder einem möglichen phantasierten zu differenzieren. Diese Differenzierung Berne beschreibt diese als Trennung des Erwachsenen-Ichs vom pathologischen Kind-Ich- bzw. Eltern-Ich-Zustandes - ist für sich allein schon heilend, weil sie zu einer Affektreduktion des unbewussten traumatischen Ereignisses beiträgt und in der Folge eine neopsychische Verarbeitung ermöglicht, die im weiteren therapeutischen Prozess zu einer Integration des unbewussten pathologischen Ichanteils führen kann. 4 Berne hat meiner Ansicht in der grafischen Darstellung nicht zwischen den differenzierten und der Realitätskontrolle zugänglichen (ich-dyston erlebten) Zuständen und den getrübten nicht der Realitätskontrolle zugänglichen (ich-synton erlebten) Zuständen unterschieden, d.h. deren Nähe zu den angemessenen Ichzuständen berücksichtigt. Man könnte auch vermuten, dass er den Aspekt einer möglichen Integration außer Acht gelassen hat, weil es ihm bei den Patienten mit schweren Störungen zunächst nur um die Trennung der angemessenen von den pathologischen Ichanteilen ging. Das topografische Modell umfasst daher einen größeren Anwendungsbereich und ist in der Praxis hilfreicher. 13
13 2. Das transaktionale Geschehen zwischen zwei Personen und die Ichzustände als deren Reaktionen. Wenn ich das transaktionale Geschehen und die Ichzustände als Ganzheit betrachte, so dürfte diese Sichtweise nicht mehr die Zustimmung aller Transaktionsanalytiker finden. Man bedenke, dass Sichtweisen Abstraktionen einer ganzheitlichen Realität sind, die für uns in ihrer Gesamtheit nicht beschreibbar ist und wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht vollständig erfassbar sein wird. Sichtweisen sind Wahrnehmungen mit Bewusstseincharakter und damit Abstraktionen unseres Denkens. Außerdem können wir nur das sehen, was wir sehen wollen; und das, was wir sehen, wird durch unsere subjektive Selbst-Weltsicht gefiltert und mitbestimmt. Sichtweisen, auch Theorien genannt, stellen somit Karten der Wirklichkeit dar und sind von der Wirklichkeit zu unterscheiden, auch wenn diese Karten Aspekte der Wirklichkeit beschreiben. Sichtweisen sind in ihrer Reichweite begrenzt und beschreiben unterschiedliche Aspekte und Ebenen der Wirklichkeit (vgl. Rath 1992). Daher sollte zu jeder Sichtweise, d.h. zu jeder Theorie der Bereich ihrer Gültigkeit angegeben werden, wo sie genau und hilfreich ist, und wo dies nicht mehr zutrifft. Es geht nicht darum, ob eine Sichtweise wahr oder falsch ist, sondern um den Bereich ihrer Gültigkeit - also um den Kontext, indem die Sichtweise bewusst wird - und ob sie hilfreich ist oder nicht. Wenden wir uns nun dem transaktionalen Geschehen und den Ichzuständen als Subganzheit einer übergeordneten Ganzheit zu. Die oben dargestellten Überlegungen lassen den Schluss zu, dass auch diese Sichtweise keinen Anspruch auf Wahrheit stellen kann, sondern zu klären ist, ob und inwieweit sie im therapeutischen Handeln hilfreich ist. Damit vertrete ich die Ansicht, dass es kein absolutes Wissen gibt und Sichtweisen und Wissen einem Wandel unterliegen. Vor solchen Wandlungen ist auch das Konzept des transaktionalen Geschehens nicht gefeit. Berne hat in der Arbeit Über das Wesen der Kommunikation die Ganzheit des kommunikativen Geschehens in den Blickpunkt gestellt, später zerlegt er diese Ganzheit in die Begriffe Ichzustände und Transaktion und fügt sie dann graphisch wieder als Pfeilbilder zwischen Ichzuständen zusammen. Hier wechselte Berne von einer holistischen (ganzheitlichen) Sicht der Welt zu einer fragmentierenden mechanistischen Sicht. Auf diesen Wechsel und deren Bedeutung für die Transaktionsanalyse, insbesondere auf die Einengung der Begrifflichkeit und den Bereich der Gültigkeit, habe ich an anderen Stellen hingewiesen (Rath 2007,a,b,c,d,e). Nun möchte ich Ihnen einen Schuhlöffel als Einstiegshilfe in meine Sicht- und Denkweise anbieten: Wenn Sie am Ufer eines Flusses sitzen und dessen Oberfläche betrachten, können Sie Ereignisse, wie Wirbel, Kräuselungen, Spritzer, Strukturen, Objekte usw. mit einer gewissen Beständigkeit wahrnehmen, wie sie sich im Flusse des Geschehens verändern, auflösen und sich Neues wieder formt Das fließende Wasser versinnbildlicht einen Prozess, der für uns Menschen bestimmte Ereignisse und Zustände, wie Kräuselungen, mit einer gewissen Beständigkeit wahrnehmen lässt. Man bedenke, dass die wahrgenommenen Kräuselungen sich aus der Bewegung des Flusses entwickeln und die Zustände sich wieder in Bewegung auflösen. Natürlich können die Ereignisse fotografiert und für einen längeren Zeitraum festhalten werden, bis der Zahn der Zeit auch daran nagt und das fotografische Bild sich verändert und in den Fluss des Geschehens zurückkehrt. 14
14 Ähnlich können die Ereignisse Ichzustände als Momentaufnahmen im Fluss des transaktionalen Geschehens wahrgenommen werden. Das bedeutet, dass sich die Ichzustände im transaktionalen Geschehen zwischen Personen gestalten, dass sie wahrgenommen werden können, sich in der Folge verändern oder auflösen und sich zu Neuem formieren. Neben der Wahrnehmung kann sich der Mensch noch der Fähigkeit des Gedächtnisses bedienen, das Ereignisse (Ichzustände) fotografiert, d.h. verarbeitet und speichert, und sie für zukünftige Wahrnehmungen verfügbar macht. Dies führt uns direkt zu Bernes Sichtweise der Psyche. Den Ursprung der Ich-Zustände sieht Berne in der Funktionsentfaltung der Psyche, von ihm als Hintergrund der Persönlichkeit aufgefasst. Berne verstand die Psyche als ein Organ, ein komplexes System, das Informationen empfängt und abruft und die Informationen verfügbar macht, während ein Individuum zur Umwelt in Beziehung steht (Holloway 1980, S.31). Die Berne sche Auffassung der Psyche als Organ, das er synonym als ein komplexes Organ bezeichnet, ist ein grundlegender Hinweis, unter welchem Gesichtspunkt er (Rath 1992, S.94) die Psyche sieht. Diese seine Sichtweise ist in die Sichtweise der Psyche als psychodynamisch holistisches System eingeflossen. Zwischen dem fließenden Wasser und dem transaktionalen Geschehens besteht eine Analogie. Dem fließenden Wasser, dem Fluss entspricht das transaktionale Geschehen, den Ereignissen Wirbel, Kräuselungen, Spritzer usw. die Ereignisse Ichzustände. Der Fluss des Wassers und das transaktionale Geschehen stellen fließende Prozesse dar, die einer steten Veränderung unterworfen sind und sich immer wieder zu neuen Ereignissen formieren. Die formgebende Wirkung, die die Ereignisse erzeugt, ist das prozessuale Geschehen. Die Wasserwirbel und die Ichzustände werden durch einen fließenden Prozess erzeugt und verändert, und das ist wichtig zu betonen existieren nicht für sich allein, sondern sind vom Prozess abhängig. Das bedeutet, Ichzustände sind nur im Zusammenhang mit dem transaktionalen Geschehen existent und daher grundsätzlich nicht davon getrennt. Mit der Darstellung der Transaktionen als Pfeile zwischen Ichzuständen hat Berne eine weitere Abstraktion vorgenommen und dadurch die Begrifflichkeit eingeengt und verabsolutiert. Kommunikation findet zwischen Personen statt und nicht zwischen Ichzuständen; diese werden erst durch das transaktionale Geschehen generiert. Ich halte daher die Definition der Transaktion durch Ichzustände und deren Darstellung durch Pfeile nicht für hilfreich und zielführend. Davon zu unterscheiden ist die Darstellung von Kommunikationsabläufen im Rollenmodell. Mit einer bestimmten Gruppierung oder Struktur von Ichzuständen lassen sich Rollen als Persönlichkeitszüge beschreiben, z. B. angepasstes Kind. Ein solcher Persönlichkeitszug drückt sich dann im transaktionalen Geschehen als spezifischer Ichzustand aus. Die interpersonale Beschreibung und Darstellung von Kommunikationsabläufen zwischen zwei Personen durch Pfeile im Rollenmodell kann ich mir in verschiedenen Anwendungsbereichen als hilfreich vorstellen. Geht es allerdings um intrapsychische Prozesse, ist die Analyse transaktionalen Geschehens, wie sie hier vorgestellt ist, angebrachter und hilfreicher. 15
15 Literatur Barnes, G. & andere (1980) Transaktionsanalyse seit Eric Berne, Band 2. Was werde ich morgen tun? Institut für Kommunikationstherapie Berne, E. (1953) Concerning the Nature of Communication. Psychiatric Quarterly 27: Dt.: Über das Wesen der Kommunikation, in Berne (1991) Berne E (1955) Primal Images and Primal Judgment, Psychiatric Quaterly 29: Dt.: Urbilder und primäre Urteile, in Berne (1991, ) Berne E (1957a) The Ego Image. Psychiatric Quarterly 31: Dt.: Das Ich-Bild, in Berne (1991, ) Berne E (1957b) Ego States in Psychotherapy. The American Journal of Psychotherapy 1957 (11) ). Dt.: Ich-zustände in der Psychotherapie, in Berne (1991, ) Berne, E. (1970) Sprechstunden für die Seele, Rowohlt, Reinbek Berne, E ([1972],1988) Was sagen Sie nachdem Sie guten Tag gesagt haben? Fischer, Frankfurt am Main Berne, E. (1984) Weg von einer Theorieder Einwirkung interpersonaler Interaktion auf nonverbale Partizipation, Zeitschrift für Transaktionsanalyse Jg. 1, Heft 1, Junfermann Verlag, Paderborn Berne, E. (1991) Transaktionsanalyse der Intuition, Junfermann, Paderborn Holloway, W.(1980) Transaktionsanalyse: Eine integrative Sicht, in Barnes & andere, Band 2 James, M & Con (1977) Techniques in Transactional Analysis, Addison-Wesley, Reading Rath, I. (1992) Ansätze zur Entwicklung einer stimmigen Theorienlandkarte der Transaktionsanalyse: Wissenschaftliche Überlegungen zu den Grundlagen der Transaktionsanalyse, Zeitschrift für Transaktionsanalyse in Theorie und Praxis, 9. Jg. Heft 2/3 (90-120) Rath, I. (2007a) Analyse transaktionalen Geschehens Teil 1: Wenn die Differenzierung zur Spaltung wird, in: Zeitschrift für Transaktionsanalyse 2007/2, Junfermann, Paderborn Rath, I. (2007b) Analyse transaktionalen Geschehens Teil 2: Was ist das für eine Art? Das ist Knickerbocker, in: Zeitschrift für Transaktionsanalyse 2007/3, Junfermann, Paderborn Rath, I. (2007c) Zur Analyse transaktionalen Geschehens, in : DGTA(2007): Thesen zur Zukunft der Transaktionsanalyse, Konstanz 2007 Rath, I. (2007d) Zur Entwicklung transaktionsanalytischer Theorie - Besinnen wir uns der gemeinsamen Wurzeln Lernen wir aus den Unterschieden (erweiterte Vortragsfassung am Kongress der DGTA in Stuttgart 2007) Veröffentlichung auf der Homepage des ÖATA und der DGTA Rath, I. (2007e) Tiefenpsychologische Transaktionsanalyse als psychodynamisch holistisches System: Autonomie eine Idee, verschiedene Blickwinkel, erweiterte Vortragsfassung am Kongress der DGTA in Stuttgart 2007) Veröffentlichung auf der Homepage des ÖATA und der DGTA Rath, I. (2008) Das Innere Kind als psychotherapeutisches Konzept, Teil 1: Historische Entwicklung und Konzept des Inneren Kindes - Hommage an Eric Berne; 2008 zur Veröffentlichung eingereicht, erscheint 2009 in ZTA, Homepage des ÖATA 16
Das Innere Kind als psychotherapeutisches Konzept 1
 Ingo Rath Das Innere Kind als psychotherapeutisches Konzept 1 Teil 1 Grundlagen und historische Entwicklung: Hommage an Eric Berne 2 1. Das Innere Kind als therapeutischer und kommerzieller Begriff In
Ingo Rath Das Innere Kind als psychotherapeutisches Konzept 1 Teil 1 Grundlagen und historische Entwicklung: Hommage an Eric Berne 2 1. Das Innere Kind als therapeutischer und kommerzieller Begriff In
Transaktionsanalyse Die Transaktionsanalyse
 Transaktionsanalyse 1. 1 Die Transaktionsanalyse Die Konzepte der Transaktionsanalyse (TA) wurde in den 60iger Jahren von Eric Berne dem amerikanischen Psychologe der auf der Psychoanalyse Freuds aufbaute,
Transaktionsanalyse 1. 1 Die Transaktionsanalyse Die Konzepte der Transaktionsanalyse (TA) wurde in den 60iger Jahren von Eric Berne dem amerikanischen Psychologe der auf der Psychoanalyse Freuds aufbaute,
1 Theoretische Grundlagen
 1 Theoretische Grundlagen In diesem ersten Kapitel wird das Konzept der Basalen Simulation definiert und übersichtlich dargestellt. Die verschiedenen Wahrnehmungsbereiche werden prägnant beschrieben, und
1 Theoretische Grundlagen In diesem ersten Kapitel wird das Konzept der Basalen Simulation definiert und übersichtlich dargestellt. Die verschiedenen Wahrnehmungsbereiche werden prägnant beschrieben, und
- kritische Reflektion eines pädagogischen Konzepts
 - kritische Reflektion eines pädagogischen Konzepts Fachtagung Aktives Erinnern. Jugendliche als Akteure historisch-politischer Bildungsarbeit 11. 12. Juni 2015 / Stuttgart Konzept oder Konzeption? 2 Konzept
- kritische Reflektion eines pädagogischen Konzepts Fachtagung Aktives Erinnern. Jugendliche als Akteure historisch-politischer Bildungsarbeit 11. 12. Juni 2015 / Stuttgart Konzept oder Konzeption? 2 Konzept
Sozialisation und Identität nach George Herbert Mead
 Sozialisation und Identität nach George Herbert Mead Universität Augsburg Lehrstuhl für Soziologie Seminar: Grundkurs Soziologie Dozent: Sasa Bosancic Referentinnen: Christine Steigberger und Catherine
Sozialisation und Identität nach George Herbert Mead Universität Augsburg Lehrstuhl für Soziologie Seminar: Grundkurs Soziologie Dozent: Sasa Bosancic Referentinnen: Christine Steigberger und Catherine
Kommunikation weitere Kommunikationsmodelle
 Transaktionsanalyse nach Eric Berne Ich-Zustands-Modell Erwachsene Menschen handeln und kommunizieren nicht immer aus der Haltung eines Erwachsenen heraus, sondern je nach Situation auch aus Positionen
Transaktionsanalyse nach Eric Berne Ich-Zustands-Modell Erwachsene Menschen handeln und kommunizieren nicht immer aus der Haltung eines Erwachsenen heraus, sondern je nach Situation auch aus Positionen
Leiter Lokführer RhB Diplomierter Manager öffentlicher Verkehr Ausbilder mit eidgenössischem Fachausweis Psychosoziale Beratung
 am Puls der Zeit Jon Andri Dorta Leiter Lokführer RhB Diplomierter Manager öffentlicher Verkehr Ausbilder mit eidgenössischem Fachausweis Psychosoziale Beratung Psychosozialer Berater in Ausbildung (TAL;
am Puls der Zeit Jon Andri Dorta Leiter Lokführer RhB Diplomierter Manager öffentlicher Verkehr Ausbilder mit eidgenössischem Fachausweis Psychosoziale Beratung Psychosozialer Berater in Ausbildung (TAL;
Pflegeheim Am Nollen Gengenbach
 Pflegeheim Am Nollen Gengenbach Geplante Revision: 01.06.2018 beachten!!! Seite 1 von 7 Unsere Gedanken zur Pflege sind... Jeder Mensch ist einzigartig und individuell. In seiner Ganzheit strebt er nach
Pflegeheim Am Nollen Gengenbach Geplante Revision: 01.06.2018 beachten!!! Seite 1 von 7 Unsere Gedanken zur Pflege sind... Jeder Mensch ist einzigartig und individuell. In seiner Ganzheit strebt er nach
Klientenzentrierte Psychotherapie
 Humanistische Psychologie und Gründerpersönlichkeit Persönlichkeitstheorie und Menschenbild Therapietheorie und Focusing Mag a Anna Steger Klinische Psychologin /Gesundheitspsychologin Klientenzentrierte
Humanistische Psychologie und Gründerpersönlichkeit Persönlichkeitstheorie und Menschenbild Therapietheorie und Focusing Mag a Anna Steger Klinische Psychologin /Gesundheitspsychologin Klientenzentrierte
Coming out - Ich bin schwul!
 Ratgeber Renate Wedel Coming out - Ich bin schwul! Situation und Beratung der Eltern Coming out - Ich bin schwul! Situation und Beratung der Eltern Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung Seite 2 2. Coming out
Ratgeber Renate Wedel Coming out - Ich bin schwul! Situation und Beratung der Eltern Coming out - Ich bin schwul! Situation und Beratung der Eltern Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung Seite 2 2. Coming out
WAS IST KOMMUNIKATION? Vorstellungen über die Sprache
 WAS IST KOMMUNIKATION? Vorstellungen über die Sprache Verständigung gelingt- manchmal Dr. Mario Fox, 2016 0 Grundsätzliches Menschliche Kommunikation dient dem Austausch von Information und entspringt
WAS IST KOMMUNIKATION? Vorstellungen über die Sprache Verständigung gelingt- manchmal Dr. Mario Fox, 2016 0 Grundsätzliches Menschliche Kommunikation dient dem Austausch von Information und entspringt
Psychomotorik und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter, Ähnlichkeiten und Unterschiede Hö 05
 Prof. Dr. Gerd Hölter Fakultät Rehabilitationswissenschaften Bewegungserziehung und Bewegungstherapie gerd.hoelter@uni-dortmund.de November 2005 30 Jahre Clemens-August-Jugendklinik Neuenkirchen Fachkongress
Prof. Dr. Gerd Hölter Fakultät Rehabilitationswissenschaften Bewegungserziehung und Bewegungstherapie gerd.hoelter@uni-dortmund.de November 2005 30 Jahre Clemens-August-Jugendklinik Neuenkirchen Fachkongress
Transitiver, intransitiver und reflexiver Bildungsbegriff
 Bildungsbegriff Transitiver, intransitiver und reflexiver Bildungsbegriff Werner Sesink Institut für Pädagogik. Technische Universität Darmstadt Pädagogisch gesehen geht es bei der Entwicklung eines Menschen
Bildungsbegriff Transitiver, intransitiver und reflexiver Bildungsbegriff Werner Sesink Institut für Pädagogik. Technische Universität Darmstadt Pädagogisch gesehen geht es bei der Entwicklung eines Menschen
43. AK-Sitzung Berlin-Brandenburg Kommunikation ; Gnewikow Kommunikation ist mehr als sprechen
 ist mehr als sprechen Einleitung und Einstimmung Katrin Ingendorf 1 ist mehr als sprechen Einleitung und Einstimmung 1. Definition (Allgemein und Speziell) 2. Sender-Empfänger-Modell 3. Das squadrat 4.
ist mehr als sprechen Einleitung und Einstimmung Katrin Ingendorf 1 ist mehr als sprechen Einleitung und Einstimmung 1. Definition (Allgemein und Speziell) 2. Sender-Empfänger-Modell 3. Das squadrat 4.
Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) = intensive psychodynamische Kurzzeittherapie
 Geisteswissenschaft Adelheid Kühn / Ellen Bröker Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) = intensive psychodynamische Kurzzeittherapie Studienarbeit Psychologisches Institut der Universität
Geisteswissenschaft Adelheid Kühn / Ellen Bröker Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) = intensive psychodynamische Kurzzeittherapie Studienarbeit Psychologisches Institut der Universität
Modelle zum Handlungslernen
 Modelle zum Handlungslernen Inhaltsübersicht 1. Ein kybernetische Modell der Handlung 2. Ein Modell der Handlungsregulation 3. Ein Modell der Wahrnehmung 4. Ein Modell des Lernens durch Handeln 5. Ein
Modelle zum Handlungslernen Inhaltsübersicht 1. Ein kybernetische Modell der Handlung 2. Ein Modell der Handlungsregulation 3. Ein Modell der Wahrnehmung 4. Ein Modell des Lernens durch Handeln 5. Ein
Ein Beispiel systemischer Interventionen
 Stroh zu Gold spinnen oder: Reframing Ein Beispiel systemischer Interventionen Irmgard Gürtler-Piel iguertler@dieberaterpraxsys.de +49 (0) 160-970 21 394 Ablaufplanung Einstimmung in das Thema Reframing
Stroh zu Gold spinnen oder: Reframing Ein Beispiel systemischer Interventionen Irmgard Gürtler-Piel iguertler@dieberaterpraxsys.de +49 (0) 160-970 21 394 Ablaufplanung Einstimmung in das Thema Reframing
Kontakt: 0160/
 1) Zu meiner Person 2) Kampfkunst/ Budo 3) Budo-Pädagogik 4) Die 5 Säulen der Budo-Pädagogik 5) Der Unterschied von Kampfkunst und Kampfsport 6) Das Konzept 7) Der Hintergrund 8) Persönliche Zielsetzung
1) Zu meiner Person 2) Kampfkunst/ Budo 3) Budo-Pädagogik 4) Die 5 Säulen der Budo-Pädagogik 5) Der Unterschied von Kampfkunst und Kampfsport 6) Das Konzept 7) Der Hintergrund 8) Persönliche Zielsetzung
Psychotherapie als Profession
 Michael B. Buchholz Psychotherapie als Profession Psychosozial-Verlag Einleitung 11 Das veränderte Bild der Psychotherapie 24 Das Herz der Profession 26 Von der abbildenden Landkarte zum konstruierten
Michael B. Buchholz Psychotherapie als Profession Psychosozial-Verlag Einleitung 11 Das veränderte Bild der Psychotherapie 24 Das Herz der Profession 26 Von der abbildenden Landkarte zum konstruierten
Begriffsdefinitionen
 Begriffsdefinitionen Sozialisation: Unter Sozialisation versteht man die Entstehung und Bildung der Persönlichkeit aufgrund ihrer Interaktion mit einer spezifischen materiellen, kulturellen und sozialen
Begriffsdefinitionen Sozialisation: Unter Sozialisation versteht man die Entstehung und Bildung der Persönlichkeit aufgrund ihrer Interaktion mit einer spezifischen materiellen, kulturellen und sozialen
Diese Powerpoint Präsentation ist mit Kommentaren versehen, damit Sie den Inhalt besser nachvollziehen können. Durch Klicken der rechten Maustaste
 Diese Powerpoint Präsentation ist mit Kommentaren versehen, damit Sie den Inhalt besser nachvollziehen können. Durch Klicken der rechten Maustaste und Anklicken Präsentation beenden können Sie den Bereich
Diese Powerpoint Präsentation ist mit Kommentaren versehen, damit Sie den Inhalt besser nachvollziehen können. Durch Klicken der rechten Maustaste und Anklicken Präsentation beenden können Sie den Bereich
1.4 Die Kraft des Bewusstseins sichtbar machen - Dr. Emoto und Kristalle als Spiegel des Bewusstseins
 1.4 Die Kraft des Bewusstseins sichtbar machen - Dr. Emoto und Kristalle als Spiegel des Bewusstseins Es gibt anschauliche Experimente, die zeigen, wie Bewusstseinsfelder auf Materie einwirken können:
1.4 Die Kraft des Bewusstseins sichtbar machen - Dr. Emoto und Kristalle als Spiegel des Bewusstseins Es gibt anschauliche Experimente, die zeigen, wie Bewusstseinsfelder auf Materie einwirken können:
Die Existenzweise des Habens ist wesentlich einfacher zu beschreiben, als die
 92 6.4. Die Existenzweise des Seins Die Existenzweise des Habens ist wesentlich einfacher zu beschreiben, als die des Seins. Beim Haben handelt es sich um toten Besitz, also um Dinge. Und Dinge können
92 6.4. Die Existenzweise des Seins Die Existenzweise des Habens ist wesentlich einfacher zu beschreiben, als die des Seins. Beim Haben handelt es sich um toten Besitz, also um Dinge. Und Dinge können
PÄDAGOGIK / PSYCHOLOGIE
 PÄDAGOGIK / PSYCHOLOGIE 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 1 Jahreslektion à 70 Minuten 1 Jahreslektion à 70 Minuten Bildungsziele Der Unterricht in Pädagogik und Psychologie trägt bei zum besseren Selbst-
PÄDAGOGIK / PSYCHOLOGIE 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 1 Jahreslektion à 70 Minuten 1 Jahreslektion à 70 Minuten Bildungsziele Der Unterricht in Pädagogik und Psychologie trägt bei zum besseren Selbst-
CME Grundlagen der Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Teil 1
 CME Grundlagen der Kommunikation zwischen Arzt und Patient Teil 1 Inhaltsverzeichnis Teil 1 Einführung: Der Arzt als Kommunikations-Manager Was ist Kommunikation? Eine Erklärung Vom Arzt zum Patienten
CME Grundlagen der Kommunikation zwischen Arzt und Patient Teil 1 Inhaltsverzeichnis Teil 1 Einführung: Der Arzt als Kommunikations-Manager Was ist Kommunikation? Eine Erklärung Vom Arzt zum Patienten
Struktur und strukturelle Störung
 Struktur und strukturelle Störung Struktur ist definiert als die Verfügbarkeit über psychische Funktionen, welche für die Organisation des Selbst und seine Beziehungen zu den inneren und äußeren Objekten
Struktur und strukturelle Störung Struktur ist definiert als die Verfügbarkeit über psychische Funktionen, welche für die Organisation des Selbst und seine Beziehungen zu den inneren und äußeren Objekten
Stadt Luzern. Leitsätze. Kinder-, Jugend- und Familienpolitik. Stadtrat
 Stadt Luzern Stadtrat Leitsätze Kinder-, Jugend- und Familienpolitik Juni 2014 Leitsätze der Kinder-, Jugend- und Familienpolitik Die Stadt Luzern setzt sich mit ihrer Kinder-, Jugend- und Familienpolitik
Stadt Luzern Stadtrat Leitsätze Kinder-, Jugend- und Familienpolitik Juni 2014 Leitsätze der Kinder-, Jugend- und Familienpolitik Die Stadt Luzern setzt sich mit ihrer Kinder-, Jugend- und Familienpolitik
Resilienz-Workshop II: Förderung von Resilienz durch Ressourcenorientierung in der Psychotherapie
 Resilienz-Workshop II: Förderung von Resilienz durch Ressourcenorientierung in der Psychotherapie Birgit Kleim, PhD Universität Zürich München, 20. Juni 2012 6/25/12 Title of the presentation, Author Page
Resilienz-Workshop II: Förderung von Resilienz durch Ressourcenorientierung in der Psychotherapie Birgit Kleim, PhD Universität Zürich München, 20. Juni 2012 6/25/12 Title of the presentation, Author Page
Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten
 Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten In der öffentlichen Diskussion über Notwendigkeit und Richtung einer Reform der frühpädagogischen Praxis in Kindertageseinrichtungen stehen zurzeit
Beobachtung und fachliche Reflexion von Kindverhalten In der öffentlichen Diskussion über Notwendigkeit und Richtung einer Reform der frühpädagogischen Praxis in Kindertageseinrichtungen stehen zurzeit
Curriculum. Weiterbildung in Gestalt- und Körpertherapie und - beratung
 Curriculum Weiterbildung in Gestalt- und Körpertherapie und - beratung - 2 - Curriculum Basistraining Gestalt- und Körpertherapie und -beratung 1. Jahr: Entwicklung der eigenen Person Im ersten Jahr steht
Curriculum Weiterbildung in Gestalt- und Körpertherapie und - beratung - 2 - Curriculum Basistraining Gestalt- und Körpertherapie und -beratung 1. Jahr: Entwicklung der eigenen Person Im ersten Jahr steht
Wertewandel in Deutschland
 Geisteswissenschaft Miriam Fonfe Wertewandel in Deutschland Ein kurzer Überblick Studienarbeit EINLEITUNG UND DARSTELLUNG DER ARBEIT 3 WERTE UND WERTEWANDEL 4 Werte und Konsum 4 Phasen des Wertewandels
Geisteswissenschaft Miriam Fonfe Wertewandel in Deutschland Ein kurzer Überblick Studienarbeit EINLEITUNG UND DARSTELLUNG DER ARBEIT 3 WERTE UND WERTEWANDEL 4 Werte und Konsum 4 Phasen des Wertewandels
Systemisches Denken Systemische Therapie
 Systemisches Denken Systemische Therapie In der systemischen Therapie sind die Persönlichkeit und deren Beziehungen zum Umfeld wichtig. Therapeutinnen und Therapeuten messen den Kommunikationsmustern grosse
Systemisches Denken Systemische Therapie In der systemischen Therapie sind die Persönlichkeit und deren Beziehungen zum Umfeld wichtig. Therapeutinnen und Therapeuten messen den Kommunikationsmustern grosse
MARX: PHILOSOPHISCHE INSPIRATIONEN
 09.11.2004 1 MARX: PHILOSOPHISCHE INSPIRATIONEN (1) HISTORISCHER RAHMEN: DIE DEUTSCHE TRADITION KANT -> [FICHTE] -> HEGEL -> MARX FEUERBACH (STRAUSS / STIRNER / HESS) (2) EINE KORRIGIERTE
09.11.2004 1 MARX: PHILOSOPHISCHE INSPIRATIONEN (1) HISTORISCHER RAHMEN: DIE DEUTSCHE TRADITION KANT -> [FICHTE] -> HEGEL -> MARX FEUERBACH (STRAUSS / STIRNER / HESS) (2) EINE KORRIGIERTE
Hurrelmann: Entwicklungsaufgaben in drei Lebensphasen
 Hurrelmann: Entwicklungsaufgaben in drei Lebensphasen Hurrelmann: Entwicklungsaufgaben im Jugendalter Entwicklung einer intellektuellen und sozialen Kompetenz Selbstverantwortlicher Erwerb schulischer
Hurrelmann: Entwicklungsaufgaben in drei Lebensphasen Hurrelmann: Entwicklungsaufgaben im Jugendalter Entwicklung einer intellektuellen und sozialen Kompetenz Selbstverantwortlicher Erwerb schulischer
Inhaltsverzeichnis. 1. Geschichte und Gegenwart der Psychotherapie... 1
 Inhaltsverzeichnis 1. Geschichte und Gegenwart der Psychotherapie... 1 Die Entwicklung der Psychotherapie... 1 Die Situation der Psychotherapie in Deutschland... 3 Ärztliche Psychotherapeuten... 3 Psychologische
Inhaltsverzeichnis 1. Geschichte und Gegenwart der Psychotherapie... 1 Die Entwicklung der Psychotherapie... 1 Die Situation der Psychotherapie in Deutschland... 3 Ärztliche Psychotherapeuten... 3 Psychologische
in der psychosozialen Beratung Transaktionsanalyse und Systemtheorie als erfolgreiches Netzwerk
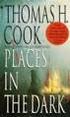 Christina Eva Maria Weber Gefühle in der psychosozialen Beratung Transaktionsanalyse und Systemtheorie als erfolgreiches Netzwerk Eine kritische Stellungnahme aus systemischer Perspektive Diplomica Verlag
Christina Eva Maria Weber Gefühle in der psychosozialen Beratung Transaktionsanalyse und Systemtheorie als erfolgreiches Netzwerk Eine kritische Stellungnahme aus systemischer Perspektive Diplomica Verlag
Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren?
 Geisteswissenschaft Anonym Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren? Essay Friedrich-Schiller-Universität
Geisteswissenschaft Anonym Diskutieren Sie aufbauend auf Lothar Krappmanns Überlegungen die Frage, was es heißen kann, aus soziologischer Perspektive Identität zu thematisieren? Essay Friedrich-Schiller-Universität
ich brauche Psychotherapie Eine Orientierungshilfe für Betroffene und deren Angehörige Ausschreibungstext
 Hilfe ich brauche Psychotherapie Eine Orientierungshilfe für Betroffene und deren Angehörige Ausschreibungstext Jeder von uns kann im Laufe des Lebens in eine Situation kommen, in der sie oder er wegen
Hilfe ich brauche Psychotherapie Eine Orientierungshilfe für Betroffene und deren Angehörige Ausschreibungstext Jeder von uns kann im Laufe des Lebens in eine Situation kommen, in der sie oder er wegen
Offener Unterricht Das Kind soll als Subjekt erkannt und respektiert werden.
 Offener Unterricht ist ein Dachbegriff für unterschiedliche Formen von Unterricht, der sowohl ältere als auch neu-reformpädagogische Konzepte aufnimmt. Die Eigenverantwortlichkeit und Mitwirkung der Schüler
Offener Unterricht ist ein Dachbegriff für unterschiedliche Formen von Unterricht, der sowohl ältere als auch neu-reformpädagogische Konzepte aufnimmt. Die Eigenverantwortlichkeit und Mitwirkung der Schüler
Interaction & Management: Soft Skills for Computer Scientists WS 2005/06. Ruth Meßmer, M.A.
 Kommunikation Interaction & Management: Soft Skills for omputer Scientists WS 2005/06 Ruth Meßmer, M.. Institut für Informatik und Gesellschaft bt. 1: Modellbildung und soziale Folgen Universit Freiburg
Kommunikation Interaction & Management: Soft Skills for omputer Scientists WS 2005/06 Ruth Meßmer, M.. Institut für Informatik und Gesellschaft bt. 1: Modellbildung und soziale Folgen Universit Freiburg
Feedback-Bogen (Feebo)
 Feedback-Bogen (Feebo) Ein Instrument zur Prävention von Ausbildungsabbrüchen Warum ein Feedback-Bogen? Im Betriebsalltag stellen Ausbildungsabbrüche eine nicht zu unterschätzende Größe dar. Der Anteil
Feedback-Bogen (Feebo) Ein Instrument zur Prävention von Ausbildungsabbrüchen Warum ein Feedback-Bogen? Im Betriebsalltag stellen Ausbildungsabbrüche eine nicht zu unterschätzende Größe dar. Der Anteil
Realgymnasium Schlanders
 Realgymnasium Schlanders Fachcurriculum aus Geschichte Klasse: 5. Klasse RG und SG Lehrer: Christof Anstein für die Fachgruppe Geschichte/ Philosophie Schuljahr 2013/2014 1/5 Lernziele/Methodisch-didaktische
Realgymnasium Schlanders Fachcurriculum aus Geschichte Klasse: 5. Klasse RG und SG Lehrer: Christof Anstein für die Fachgruppe Geschichte/ Philosophie Schuljahr 2013/2014 1/5 Lernziele/Methodisch-didaktische
Otto F. Kernberg Borderline-Störungen und pathologischer Narzißmus
 Otto F. Kernberg Borderline-Störungen und pathologischer Narzißmus Übersetzt von Hermann Schultz Suhrkamp Verlag Inhalt Zur Einführung (Robert Längs) 11 Danksagung 13 Vorwort 15 ERSTER TEIL: BORDERLINE-PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNGEN
Otto F. Kernberg Borderline-Störungen und pathologischer Narzißmus Übersetzt von Hermann Schultz Suhrkamp Verlag Inhalt Zur Einführung (Robert Längs) 11 Danksagung 13 Vorwort 15 ERSTER TEIL: BORDERLINE-PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNGEN
Berlin wird Hauptstadt
 Renate Künast Volker Ratzmann Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung Kommissionsdrucksache 0016 (bereits als Arbeitsunterlage 0019 verteilt) Berlin wird
Renate Künast Volker Ratzmann Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung Kommissionsdrucksache 0016 (bereits als Arbeitsunterlage 0019 verteilt) Berlin wird
Hypnose-Grammatik und psychosomatische Heilung. Dirk Revenstorf, Dipl. Psych. Wolfgang Weitzsäcker, Dr. med. Universität Tübingen
 Hypnose-Grammatik und psychosomatische Heilung Dirk, Dipl. Psych. Wolfgang Weitzsäcker, Dr. med. Universität Tübingen Vier nicht-reduzierbare Formen von Wissen (nach Wilber) Unbewusstes Bewusstes Individuelle
Hypnose-Grammatik und psychosomatische Heilung Dirk, Dipl. Psych. Wolfgang Weitzsäcker, Dr. med. Universität Tübingen Vier nicht-reduzierbare Formen von Wissen (nach Wilber) Unbewusstes Bewusstes Individuelle
Bedingungslose Liebe ist,
 Bedingungslose Liebe ist, wie die Sonne, die alle Lebewesen anstrahlt ohne jemals zu urteilen. Bedingungslos ist für den Verstand so wie der kalte Nebel, undurchsichtig, aber unser Herz vollführt diese
Bedingungslose Liebe ist, wie die Sonne, die alle Lebewesen anstrahlt ohne jemals zu urteilen. Bedingungslos ist für den Verstand so wie der kalte Nebel, undurchsichtig, aber unser Herz vollführt diese
Die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen: Eine fachliche und persönliche Herausforderung
 Die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen: Eine fachliche und persönliche Herausforderung In Mutter-Kind-Einrichtungen leben heute Frauen, die vielfach belastet sind. Es gibt keinen typischen Personenkreis,
Die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen: Eine fachliche und persönliche Herausforderung In Mutter-Kind-Einrichtungen leben heute Frauen, die vielfach belastet sind. Es gibt keinen typischen Personenkreis,
Negative somatische Marker Solche Marker sind als Alarmsignale zu verstehen und mahnen zur Vorsicht.
 Wahrnehmung, Achtsamkeit, Bewusstsein Somatische Marker Damasio nennt die Körpersignale somatische Marker, die das emotionale Erfahrungsgedächtnis liefert. Soma kommt aus dem Griechischen und heißt Körper.
Wahrnehmung, Achtsamkeit, Bewusstsein Somatische Marker Damasio nennt die Körpersignale somatische Marker, die das emotionale Erfahrungsgedächtnis liefert. Soma kommt aus dem Griechischen und heißt Körper.
33. Zweifel an der Abnahme und die Folgen
 33. Zweifel an der Abnahme und die Folgen Es liegt natürlich klar auf der Hand: Jegliches Zweifeln behindert den Start unserer automatischen Abnahme. Was nutzt uns eine 5-Minuten-Übung, wenn wir ansonsten
33. Zweifel an der Abnahme und die Folgen Es liegt natürlich klar auf der Hand: Jegliches Zweifeln behindert den Start unserer automatischen Abnahme. Was nutzt uns eine 5-Minuten-Übung, wenn wir ansonsten
3. Therapeutische Beziehung aus psychodynamischer Perspektive. 4. Beziehungsgestaltung im multidisziplinären therapeutischen Team
 Variationen der therapeutischen Beziehung unter psychodynamischen Aspekten Dr. med. M. Binswanger Oetwil am See, 22.01.2014 Vortragsübersicht 1. Einführung: Erste Assoziationen zum Vortragstitel 2. Therapeutische
Variationen der therapeutischen Beziehung unter psychodynamischen Aspekten Dr. med. M. Binswanger Oetwil am See, 22.01.2014 Vortragsübersicht 1. Einführung: Erste Assoziationen zum Vortragstitel 2. Therapeutische
Die Dynamik. innerer Antreiber. Transaktionsanalyse: Die Dynamik innerer Antreiber 1
 Die Dynamik innerer Antreiber Transaktionsanalyse: Die Dynamik innerer Antreiber 1 Inhalt 1. Innere Antreiber... - 3-2. Die Kehrseite des Antreibers: Die Abwertung... - 5-3. Zur Dynamik innerer Antreiber...
Die Dynamik innerer Antreiber Transaktionsanalyse: Die Dynamik innerer Antreiber 1 Inhalt 1. Innere Antreiber... - 3-2. Die Kehrseite des Antreibers: Die Abwertung... - 5-3. Zur Dynamik innerer Antreiber...
Die entwicklungslogische Didaktik statt Aussonderung. Simon Valentin, Martin Teubner
 Die entwicklungslogische Didaktik statt Aussonderung Simon Valentin, Martin Teubner Inhalt Begriffsdefinition Exklusion Separation Integration Inklusion Zahlen zur Integration Georg Feuser Entwicklungslogische
Die entwicklungslogische Didaktik statt Aussonderung Simon Valentin, Martin Teubner Inhalt Begriffsdefinition Exklusion Separation Integration Inklusion Zahlen zur Integration Georg Feuser Entwicklungslogische
Zur psychotherapeutischen Begegnung 1
 1 Ingo Rath 2013, erscheint im ZTA 2014 Zur psychotherapeutischen Begegnung 1 Haltung kommunikativer Dialog - Wirkung Zusammenfassung Im Zuge der Anerkennung der Transaktionsanalytischen Psychotherapie
1 Ingo Rath 2013, erscheint im ZTA 2014 Zur psychotherapeutischen Begegnung 1 Haltung kommunikativer Dialog - Wirkung Zusammenfassung Im Zuge der Anerkennung der Transaktionsanalytischen Psychotherapie
FOSUMOS Persönlichkeitsstörungen: Ein alternativer Blick. Felix Altorfer 1
 FOSUMOS 11.06.08 Persönlichkeitsstörungen: Ein alternativer Blick Felix Altorfer 1 Persönlichkeitsstörungen Synonyma/Historische Begriffe Psychopathische Persönlichkeit (Kraeppelin 1903, K. Schneider 1923)
FOSUMOS 11.06.08 Persönlichkeitsstörungen: Ein alternativer Blick Felix Altorfer 1 Persönlichkeitsstörungen Synonyma/Historische Begriffe Psychopathische Persönlichkeit (Kraeppelin 1903, K. Schneider 1923)
Harald Rau. Einladung zur. Kommunikationswissenschaft. Nomos
 Harald Rau Einladung zur Kommunikationswissenschaft Nomos Einführung 9 1. Kommunikation: Der Begriff und seine möglichen Dimensionen 13 1.1 Kommunikation in und mit diesem Buch: Der Dialog mit dem Leser
Harald Rau Einladung zur Kommunikationswissenschaft Nomos Einführung 9 1. Kommunikation: Der Begriff und seine möglichen Dimensionen 13 1.1 Kommunikation in und mit diesem Buch: Der Dialog mit dem Leser
TIEFENPSYCHOLOGISCHE TRANSAKTIONSANALYSE
 Ingo Rath TIEFENPSYCHOLOGISCHE TRANSAKTIONSANALYSE Einführung in Theorie und Praxis Ausbildung Inhalt Vorwort 3 Einführung in Theorie und Praxis der Tiefenpsychologischen Transaktionsanalyse Überblick:
Ingo Rath TIEFENPSYCHOLOGISCHE TRANSAKTIONSANALYSE Einführung in Theorie und Praxis Ausbildung Inhalt Vorwort 3 Einführung in Theorie und Praxis der Tiefenpsychologischen Transaktionsanalyse Überblick:
Stellungnahme der Bundesärztekammer
 Stellungnahme der Bundesärztekammer gemäß 91 Abs. 5 SGB V zur Änderung von Anlage I der Richtlinie Methoden vertragsärztliche Versorgung (MVV-RL): Berlin, 27.07.2011 Bundesärztekammer Herbert-Lewin-Platz
Stellungnahme der Bundesärztekammer gemäß 91 Abs. 5 SGB V zur Änderung von Anlage I der Richtlinie Methoden vertragsärztliche Versorgung (MVV-RL): Berlin, 27.07.2011 Bundesärztekammer Herbert-Lewin-Platz
Recovery: Wie werden psychisch kranke Menschen eigentlich wieder gesund?
 Recovery: Wie werden psychisch kranke Menschen eigentlich wieder gesund? 22. Treffen der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen im Landkreis Esslingen 13. November 2010, Esslingen Andreas Knuf www.gesundungswege.de
Recovery: Wie werden psychisch kranke Menschen eigentlich wieder gesund? 22. Treffen der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen im Landkreis Esslingen 13. November 2010, Esslingen Andreas Knuf www.gesundungswege.de
Allgemeine theoretische Grundlagen
 I Allgemeine theoretische Grundlagen Struktur der Psyche 2 Ich und Selbst 9 3 Die Orientierungsfunktionen des Ich Der innere Kompass 13 4 Persona und Schatten 23 5 Schicht für Schicht ins Unbewusste 29
I Allgemeine theoretische Grundlagen Struktur der Psyche 2 Ich und Selbst 9 3 Die Orientierungsfunktionen des Ich Der innere Kompass 13 4 Persona und Schatten 23 5 Schicht für Schicht ins Unbewusste 29
GRUNDBEGRIFFE DER SOZIOLOGIE. Markus Paulus. Radboud University Nijmegen DIPL.-PSYCH. (UNIV.), M.A.
 GRUNDBEGRIFFE DER SOZIOLOGIE Markus Paulus DIPL.-PSYCH. (UNIV.), M.A. Radboud University Nijmegen V, EXKURS: DIE THEORETISCHE PERSPEKTIVE DES SYMBOLISCHEN INTERAKTIONISMUS 1, GRUNDLAGEN Kritik: Normen
GRUNDBEGRIFFE DER SOZIOLOGIE Markus Paulus DIPL.-PSYCH. (UNIV.), M.A. Radboud University Nijmegen V, EXKURS: DIE THEORETISCHE PERSPEKTIVE DES SYMBOLISCHEN INTERAKTIONISMUS 1, GRUNDLAGEN Kritik: Normen
Bewusstsein nach Freud,Adler und Jung
 Pädagogik Sandra Meyer Bewusstsein nach Freud,Adler und Jung Studienarbeit Bewusstsein nach Freud, Adler und Jung Hausaufgabe als Leistungsnachweis im Rahmen des Seminars Bewusstsein, Intelligenz, Kreativität
Pädagogik Sandra Meyer Bewusstsein nach Freud,Adler und Jung Studienarbeit Bewusstsein nach Freud, Adler und Jung Hausaufgabe als Leistungsnachweis im Rahmen des Seminars Bewusstsein, Intelligenz, Kreativität
Biologische Psychologie I
 Biologische Psychologie I Kapitel 7 Mechanismen der Wahrnehmung, des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit Organisationsprinzipien eines sensorischen Systems: Primärer und sekundärer sensorischer Kortex
Biologische Psychologie I Kapitel 7 Mechanismen der Wahrnehmung, des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit Organisationsprinzipien eines sensorischen Systems: Primärer und sekundärer sensorischer Kortex
Katrin Schubert. Akademische Sprachtherapeutin (dbs) Bundesvorsitzende des Deutschen Bundesverbandes der akademischen Sprachtherapeuten (dbs) e.v.
 Geleitwort Bilder sind ständige Begleiter in unserem Alltag. Im Zeitalter der modernen Medien und der digitalen Kommunikation sind Bilder aus der Interaktion nicht mehr wegzudenken, ganz im Gegenteil:
Geleitwort Bilder sind ständige Begleiter in unserem Alltag. Im Zeitalter der modernen Medien und der digitalen Kommunikation sind Bilder aus der Interaktion nicht mehr wegzudenken, ganz im Gegenteil:
Das Bilanz-und Perspektivgespräch
 Das Bilanz-und Perspektivgespräch Praxissemester: Forum II, 14.02.2014 Workshop Ziele und Programm Austauschphase I Input Erarbeitungsphase Austauschphase II Übergang zur Fachgruppenphase Workshop: Ziele
Das Bilanz-und Perspektivgespräch Praxissemester: Forum II, 14.02.2014 Workshop Ziele und Programm Austauschphase I Input Erarbeitungsphase Austauschphase II Übergang zur Fachgruppenphase Workshop: Ziele
ARBEITSFÄHIGKEIT, ARBEITSWILLE UND DREIGLIEDRIGER SOZIALER ORGANISMUS
 ARBEITSFÄHIGKEIT, ARBEITSWILLE UND DREIGLIEDRIGER SOZIALER ORGANISMUS Erstveröffentlichung in: Die Dreigliederung des sozialen Organismus, I. Jg. 1919/20, Heft 8, August 1919 (GA 24, S. 48-52) Sozialistisch
ARBEITSFÄHIGKEIT, ARBEITSWILLE UND DREIGLIEDRIGER SOZIALER ORGANISMUS Erstveröffentlichung in: Die Dreigliederung des sozialen Organismus, I. Jg. 1919/20, Heft 8, August 1919 (GA 24, S. 48-52) Sozialistisch
VORWORT 7 1. EINLEITUNG 9 2. DIAGNOSTIK KULTURHISTORISCHE BETRACHTUNG ERKLÄRUNGSMODELLE DER ANOREXIA NERVOSA 28
 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT 7 1. EINLEITUNG 9 2. DIAGNOSTIK 11 2.1. KRITERIEN NACH DSM-IV (307.1) 11 2.2. KRITERIEN NACH ICD-10 (F50.0) 11 2.3. DIFFERENTIALDIAGNOSE 13 2.4. ABGRENZUNG VON ANDEREN ESSSTÖRUNGEN
INHALTSVERZEICHNIS VORWORT 7 1. EINLEITUNG 9 2. DIAGNOSTIK 11 2.1. KRITERIEN NACH DSM-IV (307.1) 11 2.2. KRITERIEN NACH ICD-10 (F50.0) 11 2.3. DIFFERENTIALDIAGNOSE 13 2.4. ABGRENZUNG VON ANDEREN ESSSTÖRUNGEN
Dadurch wird die Alltagsbeziehung mit Gott verändert, Blockaden können aufgebrochen werden, Lebenslügen werden durch Wahrheiten ersetzt:
 SOZO der andere Weg für innere Heilung und Freisetzung SOZO ist - ein griechisches Wort und heisst: retten, freisetzen, heilen, ganz sein - ein Dienst für innere Heilung und Befreiung - einfach, schnell
SOZO der andere Weg für innere Heilung und Freisetzung SOZO ist - ein griechisches Wort und heisst: retten, freisetzen, heilen, ganz sein - ein Dienst für innere Heilung und Befreiung - einfach, schnell
Verantwortung übernehmen für die Schwierigsten!
 Verantwortung übernehmen für die Schwierigsten! Fachtagung am 23./24. März 2012 in Köln Geschlossene Heimunterbringung unter ethischen Gesichtspunkten Friedrich Schiller Die Künstler Der Menschheit Würde
Verantwortung übernehmen für die Schwierigsten! Fachtagung am 23./24. März 2012 in Köln Geschlossene Heimunterbringung unter ethischen Gesichtspunkten Friedrich Schiller Die Künstler Der Menschheit Würde
Datengewinnung durch Introspektion Beobachtung/Beschreibung eigenen Erlebens wie Gedanken, Wünsche, Motive, Träume, Erinnerungen.
 ERLEBNISPSYCHOLOGIE Datengewinnung durch Introspektion Beobachtung/Beschreibung eigenen Erlebens wie Gedanken, Wünsche, Motive, Träume, Erinnerungen. Hauptvertreter Wiener Schule (Karl Bühler, Hubert Rohracher,
ERLEBNISPSYCHOLOGIE Datengewinnung durch Introspektion Beobachtung/Beschreibung eigenen Erlebens wie Gedanken, Wünsche, Motive, Träume, Erinnerungen. Hauptvertreter Wiener Schule (Karl Bühler, Hubert Rohracher,
Was ist Gesundheit? Teil 1a: Theorien von
 Was ist Gesundheit? Teil 1a: Theorien von von Gesundheit und Krankheit VO SS 2009, 24.3.2009 Univ.Doz. Mag. Dr. Wolfgang Dür W. Dür, VO SS 2009 Gesundheit Gesundheit/Krankheit in verschiedenen Perspektiven
Was ist Gesundheit? Teil 1a: Theorien von von Gesundheit und Krankheit VO SS 2009, 24.3.2009 Univ.Doz. Mag. Dr. Wolfgang Dür W. Dür, VO SS 2009 Gesundheit Gesundheit/Krankheit in verschiedenen Perspektiven
Harald Rau, Einladung zur Kommunikationswissenschaft
 Zusatzmaterialien zum UTB-Band Harald Rau, Einladung zur Kommunikationswissenschaft bereitgestellt über www.utb-shop.de/9783825239152 Diese Einladung begeistert für das Studium der Kommunikationswissenschaft:
Zusatzmaterialien zum UTB-Band Harald Rau, Einladung zur Kommunikationswissenschaft bereitgestellt über www.utb-shop.de/9783825239152 Diese Einladung begeistert für das Studium der Kommunikationswissenschaft:
Selbstverletzendes Verhalten
 Selbstverletzendes Verhalten Erscheinungsformen, Ursachen und Interventionsmöglichkeiten von Franz Petermann und Sandra Winkel mit einem Beitrag von Gerhard Libal, Paul L Plener und Jörg M. Fegert GÖTTINGEN
Selbstverletzendes Verhalten Erscheinungsformen, Ursachen und Interventionsmöglichkeiten von Franz Petermann und Sandra Winkel mit einem Beitrag von Gerhard Libal, Paul L Plener und Jörg M. Fegert GÖTTINGEN
Zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a priori
 Geisteswissenschaft Pola Sarah Zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a priori Essay Essay zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a
Geisteswissenschaft Pola Sarah Zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a priori Essay Essay zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a
Thema / Inhalt allgemeine Leistungsziele spezifische Leistungsziele Lehrmittel: Kapitel Semester
 Schullehrplan Behindertenbetreuung 3-jährige Grundbildung Bereich: Betreuen und Begleiten Thema / Inhalt allgemeine Leistungsziele spezifische Leistungsziele Lehrmittel: Kapitel Semester Alltagsgestaltung
Schullehrplan Behindertenbetreuung 3-jährige Grundbildung Bereich: Betreuen und Begleiten Thema / Inhalt allgemeine Leistungsziele spezifische Leistungsziele Lehrmittel: Kapitel Semester Alltagsgestaltung
Leseprobe S. 2, 12-17
 Leseprobe S. 2, 12-17 Stefan Elz Einheit im Alltag Meditation in Aktion - still sein, beobachten und gleichzeitig handeln Leseprobe Copyright Lichtels Verlag 13 Einführung Abgehetzt, von einem Gedanken
Leseprobe S. 2, 12-17 Stefan Elz Einheit im Alltag Meditation in Aktion - still sein, beobachten und gleichzeitig handeln Leseprobe Copyright Lichtels Verlag 13 Einführung Abgehetzt, von einem Gedanken
Praktische Anleitung im Umgang mit Demenz
 Praktische Anleitung im Umgang mit Demenz Die geistigen Bilder, die helfen, ein Konzept im Kopf zu erstellen, fügen sich bei Menschen mit Demenz nicht mehr recht zusammen. Der Demenzkranke hat Schwierigkeiten
Praktische Anleitung im Umgang mit Demenz Die geistigen Bilder, die helfen, ein Konzept im Kopf zu erstellen, fügen sich bei Menschen mit Demenz nicht mehr recht zusammen. Der Demenzkranke hat Schwierigkeiten
Thema / Inhalt allgemeine Leistungsziele spezifische Leistungsziele Lehrmittel: Kapitel Semester
 Schullehrplan Behindertenbetreuung FBD 2-jährige Grundbildung Bereich: Begleiten und Betreuen Thema / Inhalt allgemeine Leistungsziele spezifische Leistungsziele Lehrmittel: Kapitel Semester Alltagsgestaltung
Schullehrplan Behindertenbetreuung FBD 2-jährige Grundbildung Bereich: Begleiten und Betreuen Thema / Inhalt allgemeine Leistungsziele spezifische Leistungsziele Lehrmittel: Kapitel Semester Alltagsgestaltung
Montessori-Pädagogik neuropsychologisch verstanden und heilpädagogisch praktiziert
 8 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Ingeborg Milz Montessori-Pädagogik neuropsychologisch verstanden
8 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Ingeborg Milz Montessori-Pädagogik neuropsychologisch verstanden
Rede von Bundespräsident Heinz Fischer anlässlich der Trauerfeier für Altbundespräsident Johannes Rau, 7. Februar 2006, Berlin
 Rede von Bundespräsident Heinz Fischer anlässlich der Trauerfeier für Altbundespräsident Johannes Rau, 7. Februar 2006, Berlin Es gilt das Gesprochene Wort! Vom Sterben vor der Zeit hat Bruno Kreisky manchmal
Rede von Bundespräsident Heinz Fischer anlässlich der Trauerfeier für Altbundespräsident Johannes Rau, 7. Februar 2006, Berlin Es gilt das Gesprochene Wort! Vom Sterben vor der Zeit hat Bruno Kreisky manchmal
Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen
 Starken Gefühlen mit Kommunikation begegnen Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen DGSF Tagung 2015 Magdeburg Silja Thieme Psychotherapeutin /Supervisorin Seebruck www.silja- Thieme.de Definition
Starken Gefühlen mit Kommunikation begegnen Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen DGSF Tagung 2015 Magdeburg Silja Thieme Psychotherapeutin /Supervisorin Seebruck www.silja- Thieme.de Definition
Probeklausur für den Studiengang B-BPG-01-a, B-PV-01-1-a. Einführung in die Pflegewissenschaft
 Probeklausur für den Studiengang B-BPG-01-a, B-PV-01-1-a Einführung in die Pflegewissenschaft für Dienstag, den 18.01.11 Sehr geehrte Studierende, wie vereinbart hier die Probeklausur zum Abschluss des
Probeklausur für den Studiengang B-BPG-01-a, B-PV-01-1-a Einführung in die Pflegewissenschaft für Dienstag, den 18.01.11 Sehr geehrte Studierende, wie vereinbart hier die Probeklausur zum Abschluss des
Teil 1 Entwicklungspsychologie, allgemeine Neurosenlehre
 Teil 1 Entwicklungspsychologie, allgemeine Neurosenlehre 1 Die vier Psychologien der Psychoanalyse.................... 3 Triebpsychologie/Libidotheorie (nach Freud)................. 4 Strukturmodell (
Teil 1 Entwicklungspsychologie, allgemeine Neurosenlehre 1 Die vier Psychologien der Psychoanalyse.................... 3 Triebpsychologie/Libidotheorie (nach Freud)................. 4 Strukturmodell (
Sr. Liliane Juchli und ihr ganzheitliches Pflegeverst
 Sr. Liliane Juchli und ihr ganzheitliches Pflegeverst thema Der Schweizer Nachname Juchli steht für Generationen von Pflegenden als Synonym für Pflegetheorie. Warum? 1971 verfasste Schwester Liliane Juchli
Sr. Liliane Juchli und ihr ganzheitliches Pflegeverst thema Der Schweizer Nachname Juchli steht für Generationen von Pflegenden als Synonym für Pflegetheorie. Warum? 1971 verfasste Schwester Liliane Juchli
Fragebogen zur Einleitung oder Verlängerung einer ambulanten Psychotherapie
 Fragebogen zur Einleitung oder Verlängerung einer ambulanten Psychotherapie Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, dieser Fragebogen soll helfen, Ihre ambulante Psychotherapie einzuleiten bzw.
Fragebogen zur Einleitung oder Verlängerung einer ambulanten Psychotherapie Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, dieser Fragebogen soll helfen, Ihre ambulante Psychotherapie einzuleiten bzw.
Das Symbiosetrauma. Systemische Therapie im Kontext von Trauma und Bindung. Steyerberg, 11. September 2011. www.franz-ruppert.de
 Das Symbiosetrauma Systemische Therapie im Kontext von Trauma und Bindung Steyerberg, 11. September 2011 www.franz-ruppert.de 09.09.2011 (c) Prof. Dr. Franz Ruppert 1 Reihe Leben Lernen bei Klett-Cotta
Das Symbiosetrauma Systemische Therapie im Kontext von Trauma und Bindung Steyerberg, 11. September 2011 www.franz-ruppert.de 09.09.2011 (c) Prof. Dr. Franz Ruppert 1 Reihe Leben Lernen bei Klett-Cotta
erst mal wünsche ich Dir und Deiner Familie ein frohes Neues Jahr.
 Denkstrukturen Hallo lieber Tan, erst mal wünsche ich Dir und Deiner Familie ein frohes Neues Jahr. Jetzt habe ich schon wieder Fragen, die einfach bei dem Studium der Texte und der praktischen Umsetzung
Denkstrukturen Hallo lieber Tan, erst mal wünsche ich Dir und Deiner Familie ein frohes Neues Jahr. Jetzt habe ich schon wieder Fragen, die einfach bei dem Studium der Texte und der praktischen Umsetzung
Analyse der Tagebücher der Anne Frank
 Germanistik Amely Braunger Analyse der Tagebücher der Anne Frank Unter Einbeziehung der Theorie 'Autobiografie als literarischer Akt' von Elisabeth W. Bruss Studienarbeit 2 INHALTSVERZEICHNIS 2 1. EINLEITUNG
Germanistik Amely Braunger Analyse der Tagebücher der Anne Frank Unter Einbeziehung der Theorie 'Autobiografie als literarischer Akt' von Elisabeth W. Bruss Studienarbeit 2 INHALTSVERZEICHNIS 2 1. EINLEITUNG
VERHANDLUNGSFÜHRUNG UND PRÄSENTATIONSTECHNIK. Youssef Siahi WS 2011/12 Aktives zuhören- Spiegeln-paraphrasieren
 VERHANDLUNGSFÜHRUNG UND PRÄSENTATIONSTECHNIK Youssef Siahi WS 2011/12 Aktives zuhören- Spiegeln-paraphrasieren 2 Wer zuhört kann eine Aussage verstehen und richtig wiedergegeben. Transferthema 3 Aktives
VERHANDLUNGSFÜHRUNG UND PRÄSENTATIONSTECHNIK Youssef Siahi WS 2011/12 Aktives zuhören- Spiegeln-paraphrasieren 2 Wer zuhört kann eine Aussage verstehen und richtig wiedergegeben. Transferthema 3 Aktives
Tiefenpsychologische Körpertherapie - Konzeption -
 Martin Pritzel Staatlich anerkannter Erzieher und Körpertherapeut Hertinger Str. 48 59423 Unna Tel. : 02303/29 19 20 1 Fax. : 02303/29 19 21 1 Mobil : 0163 /25 04 42 5 Mail : info@martin-pritzel.de Über
Martin Pritzel Staatlich anerkannter Erzieher und Körpertherapeut Hertinger Str. 48 59423 Unna Tel. : 02303/29 19 20 1 Fax. : 02303/29 19 21 1 Mobil : 0163 /25 04 42 5 Mail : info@martin-pritzel.de Über
Versuch einer Annäherung an den Begriff der Monade und an die Beziehung zwischen Seele und Körper in der Monadologie von Leibniz
 Versuch einer Annäherung an den Begriff der Monade und an die Beziehung zwischen Seele und Körper in der Monadologie von Leibniz Der Lernende versucht im ersten Teil zu verstehen, wie Leibniz die Monade
Versuch einer Annäherung an den Begriff der Monade und an die Beziehung zwischen Seele und Körper in der Monadologie von Leibniz Der Lernende versucht im ersten Teil zu verstehen, wie Leibniz die Monade
Übermäßige Sorgen bei anderen psychischen Störungen
 Ist dies die richtige Therapie für Sie? Merkmale der generalisierten Angst 19 Übermäßige Sorgen bei anderen psychischen Störungen Generalisierte Angst ist ein häufiges Nebenmerkmal von vielen unterschiedlichen
Ist dies die richtige Therapie für Sie? Merkmale der generalisierten Angst 19 Übermäßige Sorgen bei anderen psychischen Störungen Generalisierte Angst ist ein häufiges Nebenmerkmal von vielen unterschiedlichen
Persönlichkeit und Persönlichkeitsunterschiede
 9 Persönlichkeit und Persönlichkeitsunterschiede 1 Inhalt Die Beschäftigung mit der menschlichen Persönlichkeit spielt in unserem Alltag eine zentrale Rolle. Wir greifen auf das globale Konzept Persönlichkeit
9 Persönlichkeit und Persönlichkeitsunterschiede 1 Inhalt Die Beschäftigung mit der menschlichen Persönlichkeit spielt in unserem Alltag eine zentrale Rolle. Wir greifen auf das globale Konzept Persönlichkeit
Demenz und Selbstbestimmung eine Frage der Haltung?!
 Demenz und Selbstbestimmung eine Frage der Haltung?! Swen Staack Dipl.-Soz.Päd.; Vorstandsmitglied Pflegebedürftigkeit und Selbstbestimmung Realität oder Utopie? Braunschweig 2013 2038 Definition Selbstbestimmung
Demenz und Selbstbestimmung eine Frage der Haltung?! Swen Staack Dipl.-Soz.Päd.; Vorstandsmitglied Pflegebedürftigkeit und Selbstbestimmung Realität oder Utopie? Braunschweig 2013 2038 Definition Selbstbestimmung
Ich begrüsse Sie zum Impulsvortrag zum Thema: «Körpersprache geht uns alle an»
 Ich begrüsse Sie zum Impulsvortrag zum Thema: «Körpersprache geht uns alle an» Meine Ziele oder meine Absicht für Heute Abend: Sie erhalten ein Wissen über die Zusammensetzung der KS Sie erhalten Tipps
Ich begrüsse Sie zum Impulsvortrag zum Thema: «Körpersprache geht uns alle an» Meine Ziele oder meine Absicht für Heute Abend: Sie erhalten ein Wissen über die Zusammensetzung der KS Sie erhalten Tipps
Verlass mich nicht, wenn ich schwach werde
 Sterbebegleitung-Intensivseminar Verlass mich nicht, wenn ich schwach werde Zertifikat-Seminar Dozent Stefan Knor, Dipl.-Theologe Termine 06.-07.10.2015 14.10.2015 20.10.2015 28.10.2015 09.12.2015 (Reflexionstag)
Sterbebegleitung-Intensivseminar Verlass mich nicht, wenn ich schwach werde Zertifikat-Seminar Dozent Stefan Knor, Dipl.-Theologe Termine 06.-07.10.2015 14.10.2015 20.10.2015 28.10.2015 09.12.2015 (Reflexionstag)
Axiome der Kommunikation nach Watzlawick / Beavin / Jackson
 Axiome der Kommunikation nach Watzlawick / Beavin / Jackson 1.Axiom 2. Axiom 3. Axiom 4. Axiom 5. Axiom Man kann nicht nicht kommunizieren Jede Kommunikation besitzt einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt
Axiome der Kommunikation nach Watzlawick / Beavin / Jackson 1.Axiom 2. Axiom 3. Axiom 4. Axiom 5. Axiom Man kann nicht nicht kommunizieren Jede Kommunikation besitzt einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt
Gesetzestext (Vorschlag für die Verankerung eines Artikels in der Bundesverfassung)
 Gesetzestext (Vorschlag für die Verankerung eines Artikels in der Bundesverfassung) Recht auf Bildung Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Bildung soll auf die volle Entfaltung der Persönlichkeit, der
Gesetzestext (Vorschlag für die Verankerung eines Artikels in der Bundesverfassung) Recht auf Bildung Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Bildung soll auf die volle Entfaltung der Persönlichkeit, der
Das Trauma der Liebe. Hospitalhof Stuttgart 23. Juli Prof. Dr. Franz Ruppert 1
 Das Trauma der Liebe Hospitalhof Stuttgart 23. Juli 2015 www.franz-ruppert.de 20.07.2015 Prof. Dr. Franz Ruppert 1 Was ist Liebe? Ausdruck des Bedürfnisses nach Sicherheit, Zuwendung, Geborgenheit, Nähe,
Das Trauma der Liebe Hospitalhof Stuttgart 23. Juli 2015 www.franz-ruppert.de 20.07.2015 Prof. Dr. Franz Ruppert 1 Was ist Liebe? Ausdruck des Bedürfnisses nach Sicherheit, Zuwendung, Geborgenheit, Nähe,
Über den Zusammenhang von Gehirn, Gesellschaft und Geschlecht
 Geisteswissenschaft Anonym Über den Zusammenhang von Gehirn, Gesellschaft und Geschlecht Studienarbeit Humboldt Universität - Berlin Kulturwissenschaftliches Seminar Hauptseminar: Das Unbewusste Sommersemester
Geisteswissenschaft Anonym Über den Zusammenhang von Gehirn, Gesellschaft und Geschlecht Studienarbeit Humboldt Universität - Berlin Kulturwissenschaftliches Seminar Hauptseminar: Das Unbewusste Sommersemester
Work-Life-Balance. S Termin: Beitrag von U. Schraps
 Work-Life-Balance S 12671 Termin: 22.11.2007 Beitrag von U. Schraps 1 Referate zum Thema Formen der Lebensgestaltung Ergebnisse aus den Forschungsprojekten PROFIL & KOMPETENT (Lea Schulte) Zu Segmentation
Work-Life-Balance S 12671 Termin: 22.11.2007 Beitrag von U. Schraps 1 Referate zum Thema Formen der Lebensgestaltung Ergebnisse aus den Forschungsprojekten PROFIL & KOMPETENT (Lea Schulte) Zu Segmentation
