MODULHANDBUCH. Bachelor Chemieingenieurwesen. Vertiefungsrichtungen. Angewandte Chemie (AC) Chemische Verfahrenstechnik (CV)
|
|
|
- Sylvia Buchholz
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 MODULHANDBUCH Bachelor Chemieingenieurwesen Vertiefungsrichtungen Angewandte Chemie (AC) Chemische Verfahrenstechnik (CV) ab WS 2016/2017 Stand
2 2
3 Inhalt STUDIENVERLAUF BACHELOR CHEMIEINGENIEURWESEN... 5 ÜBERSICHT MODULE DES 4. BIS 6. SEMESTERS VERTIEFUNG ANGEWANDTE CHEMIE... 6 ÜBERSICHT MODULE DES 4. BIS 6. SEMESTERS VERTIEFUNG CHEMISCHE VERFAHRENSTECHNIK... 7 ALLGEMEINE CHEMIE... 8 ANALYTISCHE CHEMIE MATHEMATIK TECHNISCHE GRUNDLAGEN PHYSIK ORGANISCHE CHEMIE ANORGANISCHE CHEMIE PHYSIKALISCHE CHEMIE MATHEMATIK APPARATE UND PROZESSE ORGANISCHE CHEMIE PHYSIKALISCHE CHEMIE ANORGANISCHE CHEMIE WERKSTOFFTECHNIK INDUSTRIELLE CHEMIE GRUNDLAGEN DER CHEMISCHEN VERFAHRENSTECHNIK INSTRUMENTELLE ANALYTIK TECHNISCHES ENGLISCH ANGEWANDTE PHYSIKALISCHE CHEMIE (CV) WÄRME- UND STOFFTRANSPORT (CV) TECHNISCHE THERMODYNAMIK UND STRÖMUNGSLEHRE (CV) CHEMISCHE REAKTIONSTECHNIK (CV) CHEMISCHE VERFAHRENS- UND UMWELTTECHNIK (CV) ANLAGENENGINEERING (CV) TECHNISCHE DOKUMENTATION UND LITERATURRECHERCHE (AC, CV) ORGANISCHE CHEMIE 3 (AC) GRUNDLAGEN DER MATERIALWISSENSCHAFTEN (AC) AUFBAU UND VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE (AC) INSTRUMENTELLE ANALYTIK 2 (AC)
4 FUNKTIONSMATERIALIEN (AC) MAKROMOLEKULARE CHEMIE (AC) PRAXISPHASE BACHELORARBEIT / KOLLOQUIUM
5 Studienverlauf Bachelor Chemieingenieurwesen Module des 1. bis 3. Semesters für beide Vertiefungsrichtungen Abkürzungen: SWS = Semesterwochenstunde/n V = Vorlesung S = Seminar LP = Leistungspunkt/e Ü = Übung P = Praktikum SU = Seminaristischer Unterricht PE = Prüfungselement MP = Modulprüfung Modul V P Ü LP PE V P Ü LP PE V P Ü LP PE Allgemeine Chemie MP Analytische Chemie MP Mathematik MP Technische Grundlagen MP Physik MP Organische Chemie MP Anorganische Chemie MP Physikalische Chemie MP Mathematik MP Apparate und Prozesse MP Organische Chemie MP Physikalische Chemie MP Anorganische Chemie MP Werkstofftechnik MP Industrielle Chemie MP Modul Credits / LP Modulverantwortlicher Prof./ Lehrende (Prof.) Allgemeine Chemie 7 Jüstel, Bredol, Kynast, Schlitter, Weiper-Idelmann, Schupp Analytische Chemie 5 Jüstel, Kynast, Möller Mathematik 1 7 Pott-Langemeyer Technische Grundlagen 4 Ebeling Physik 7 Mertins (FB Pysik.Technik) Organische Chemie 1 6 Weiper-Idelmann, Schupp Anorganische Chemie 1 7 Jüstel, Kynast Physikalische Chemie1 6 Bredol, Schlitter Mathematik 2 6 Pott-Langemeyer Apparate und Prozesse 5 Ebeling Organische Chemie 2 8 Weiper-Idelmann, Schupp Physikalische Chemie 2 7 Bredol, Schlitter Anorganische Chemie 2 7 Kynast, Jüstel Werkstofftechnik 5 Kötting (FB Maschinenbau) Industrielle Chemie 5 Schupp, Frau Dr. Altendorfner 5
6 Übersicht Module des 4. bis 6. Semesters Vertiefung Angewandte Chemie Abkürzungen: SWS = Semesterwochenstunde/n V = Vorlesung S = Seminar LP = Leistungspunkt/e Ü = Übung P = Praktikum SU = Seminaristischer Unterricht PE = Prüfungselement MP = Modulprüfung Modul V P Ü CP PE V P Ü LP PE V P Ü LP Grundlagen der Chemischen Verfahrenstechnik MP Instrumentelle Analytik MP Technisches Englisch MP Organische Chemie MP Grundlagen der Materialwissenschaften MP Aufbau und Verarbeitung der Kunststoffe MP Instrumentelle Analytik MP Funktionsmaterialien MP Makromolekulare Chemie MP Technische Dokumentation und Literaturrecherche MP Praxisphase 15 Bachelorarbeit 12 Kolloquium 3 SUMME Module AC Grundlagen der Chemischen Verfahrenstechnik Credits / LP Instrumentelle Analytik 1 5 Technisches Englisch 4 5 Guderian Modulverantwortlicher Prof./ Lehrende (Prof.) Schlitter, Kreyenschmidt Ermen Organische Chemie 3 5 Schupp, Weiper-Idelmann Grundlagen der Materialwissenschaften Aufbau und Verarbeitung der Kunststoffe Instrumentelle Analytik 2 8 Funktionsmaterialien 8 Makromolekulare Chemie 8 Technische Dokumentation und Literaturrecherche 5 Jüstel, Bredol, Kynast 5 Lorenz 5 Kreyenschmidt, Schlitter Kynast, Bredol, Jüstel Lorenz Schupp Stephanie Möller; Mirjam Hölscher, M.A. 6
7 Übersicht Module des 4. bis 6. Semesters Vertiefung Chemische Verfahrenstechnik Abkürzungen: SWS = Semesterwochenstunde/n V = Vorlesung S = Seminar LP = Leistungspunkt/e Ü = Übung P = Praktikum SU = Seminaristischer Unterricht PE = Prüfungselement MP = Modulprüfung Modul V P Ü LP PE V P Ü LP PE V P LP PE Grundlagen der Chemischen Verfahrenstechnik MP Instrumentelle Analytik MP Technisches Englisch MP Angewandte Physikalische Chemie MP Wärme- und Stofftransport MP Technische Thermodynamik und Strömungslehre MP Chemische Reaktionstechnik MP Chemische Verfahrens- und Umwelttechnik MP Anlagenengineering MP Technische Dokumentation MP und Literaturrecherche Praxisphase 15 PE Bachelorarbeit 12 Kolloquium Module CV Grundlagen der Chemischen Verfahrenstechnik Credits / LP Modulverantwortlicher Prof./ Lehrende (Prof.) 5 Guderian Instrumentelle Analytik 1 5 Schlitter, Kreyenschmidt Technisches Englisch 4 Ermen Angewandte Physikalische Chemie 5 Dettmann, Arlt Wärme- und Stofftransport Technische Thermodynamik und Strömungslehre 5 Dettmann 5 Ebeling, Dettmann Chemische Reaktionstechnik 8 Jordan, Chemische Verfahrens- und Umwelttechnik 8 Dettmann, Ebeling Anlagenengineering 8 Ebeling, Wilming Technische Dokumentation und Literaturrecherche 5 Schupp Stephanie Möller; Mirjam Hölscher, M.A. 7
8 Allgemeine Chemie 1 Modulbezeichnung / Title of Module Allgemeine Chemie (11100) 2 Modulturnus/regular: in SoSe/summer term, WiSe / winter term Veranstaltungssprache/n / Language Deutsch Weitere, nämlich: Prüfungs-Kennnummer (HIS-POS/LSF) Dauer des Moduls:/Duration: 1 Semester 2 Semester 3 Angebot für folgenden Studiengang/folgende Studiengänge Course of study: Pflicht, Wahl, Wahlpflicht Angebot im Fachsemester Bachelor Chemieingenieurwesen Pflicht 1 Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen Chemietechnik (jedoch mit Praktikum) Pflicht Kontaktzeiten -inkl. Prüf. Contact times Selbststudium Self-study Lehrform Form of teaching SWS Std. pro Sem. SWS x i.d.r. 15 Semesterwochen Vorlesung / Lectures 4 60 Übung / Exercise 2 30 Praktikum / Lab course Form (z.b. Vor-/Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung, Ausarbeitung von Hausarbeiten, Recherche) Vor- und Nachbereitung der Vorlesungen und Übungen, Prüfungsvorbeitung Std. pro Sem./ Hrs/semester 120 Summe Kontaktzeit 90 Std. Summe Selbststudium self-study total: 120 Std. 6 Arbeitsaufwand (Workload) 7 Lernergebnisse / Lernziele: Summe Kontaktzeit + Summe Selbststudium Leistungspunkte (i.d.r. 30 Std. = 1 LP) Credits 210 Std. 7 LP Die Studierenden werden in die Chemie eingeführt und mit den elementaren Grundlagen und Konzepten der organischen, anorganischen und physikalischen Chemie vertraut gemacht. Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden fähig, die grundlegenden Konzepte und Modelle der Chemie zu verstehen, wiederzugeben und anzuwenden. 8
9 8 Inhalt: Physikalisch-chemische Grundlagen: Maßeinheiten, SI-System, Systemdefinitionen, Anwendung des idealen Gasgesetzes, Volumenarbeit 1. Hauptsatz der Thermodynamik, innere Energie, Enthalpie, Wärmekapazitäten, thermochemische Gleichungen 2. Hauptsatz der Thermodynamik Entropie, statistische und thermodynamische Interpretation, freie Enthalpie und ihr Zusammenhang Phasengleichgewichten, chemischen Gleichgewichten (Massenwirkungsgesetz) und elektrochemisches Gleichgewichte (Nernstsche Gleichung) anhand von Beispielen. Grundlagen anorganischer Chemie: Aufbau der Atome, Struktur einfacher Moleküle und Festkörper, Radioaktivität, chemische Bindung und Bindungstypen (ionische Bindung, kovalente Bindung, metallische Bindung), Oxidationsstufen, Oxidationszahlen, Redoxreaktionen, Säure-Base Konzepte und Chemie Grundlagen organischer Chemie: Bindungen des Kohlenstoffs, Hybridisierung, Valence-Bond-Modell der chemischen Bindung Dipolmoment und Formalladungen organischer Moleküle Reaktivität, Nukleophile, Elektrophile, Radikale Funktionelle Gruppen als Ordnungsprinzip der organischen Chemie Elektronenverteilung in organischen Verbindungen: Mesomerie, Aromatizität Einführung in die Nomenklatur einfacher organischer Moleküle Formelschreibweise, Darstellung von Reaktionsmechanismen Die Grundmechanismen: Substitution, Addition, Eliminierung Nukleophile Substitution, Elektrophile Substitution. 9 Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Immatrikulation 10 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Prüfung 11 Prüfungsformen und umfang: Klausur: 180 Minuten oder mündliche Prüfung 12 Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung: Immatrikulation und fristgerechte Online-Anmeldung über das LSF-Portal innerhalb des Anmeldezeitraums Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Jüstel 15 Hauptamtlich Lehrende: Professoren Dr.: Bredol, Kynast, Schlitter, Weiper-Idelmann, Schupp Dr. Stephanie Möller 16 Ergänzende Informationen / Literatur: Vorlesungsskript (online). Literatur wird in Vorlesung bekannt gegeben. 9
10 Analytische Chemie 1 Modulbezeichnung / Title of Module Analytische Chemie (11200) 2 Modulturnus/regular: in SoSe/summer term, WiSe / winter term Veranstaltungssprache/n / Language Deutsch Weitere, nämlich: Prüfungs-Kennnummer (HIS-POS/LSF) Dauer des Moduls:/Duration: 1 Semester 2 Semester 3 Angebot für folgenden Studiengang/folgende Studiengänge Pflicht, Wahl, Angebot im Course of study: Wahlpflicht Fachsemester Bachelor Chemieingenieurwesen Pflicht Kontaktzeiten -inkl. Prüf. Contact times Selbststudium Self-study Lehrform Form of teaching SWS Std. pro Sem. SWS x i.d.r. 15 Semesterwochen Vorlesung / Lectures 1 15 Übung / Exercise 1 15 Praktikum (Anwesenheitspflicht) Lab course(compulsory attendance) 3 45 Form (z.b. Vor-/Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung, Ausarbeitung von Hausarbeiten, Recherche) Vor- und Nachbereitung der Vorlesungen und Übungen, Nachbereitung des Praktikums, Prüfungsvorbereitung Std. pro Sem./ Hrs/semester 75 Summe Kontaktzeit 75 Std. Summe Selbststudium self-study total: 75 Std. 6 Arbeitsaufwand (Workload) 7 Lernergebnisse / Lernziele: Summe Kontaktzeit + Summe Selbststudium Leistungspunkte (i.d.r. 30 Std. = 1 LP) Credits 150 Std. 5 LP Die Studierenden verstehen die elementaren Arbeitstechniken der qualitativen und quantitativen analytischen Chemie und können sie sinngemäß auf neue Probleme anwenden. Darüber hinaus verfügen sie über elementare Stoffkenntnisse der anorganischen Chemie und beherrschen grundlegende Konzepte und Zusammenhänge der Chemie wässeriger Lösungen. 10
11 8 Inhalt: Einteilung homogener und heterogener Stoffe, Stoffeigenschaften, physikalische Trennung heterogener und homogener Systeme, Massenwirkungsgesetz und Löslichkeitsprodukt, Aktivität und Aktivitätskoeffizient, isoelektrischer Punkt, Grundlagen der Gravimetrie, Gang einer gravimetrischen Analyse, Fällungsreaktionen, Grundlagen der Volumetrie, Säure-Base-Titrationen, Redoxtitrationen, Fällungstitrationen, Komplexometrie, (optische) Vorproben, Boraxperle, Phosphorsalzperle, Sodaauszug, Einzelionennachweise der Anionen und der Kationen, Kationentrennungsgang (HCl-, H2S-, Urotropin-, (NH4)2S- und (NH4)2CO3- und lösliche Gruppe, Freiberger Aufschluss, Soda-Pottasche-Aufschluss, oxidativer Aufschluss, saurer Aufschluss. 9 Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Immatrikulation 10 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Prüfung und Anerkennung der Studienleistungen (erfolgreiche Teilnahme am Praktikum und Anfertigung der Versuchsprotokolle, schriftliche Ausarbeitungen und/oder mündliche Präsentationen zu den Praktikumsversuchen) durch Nachweis und Bekanntgabe an das Prüfungsamt. 11 Prüfungsformen und umfang: Klausur: 180 Minuten oder mündliche Prüfung 12 Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung : Immatrikulation und fristgerechte Online-Anmeldung über das LSF-Portal innerhalb des Anmeldezeitraums Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Jüstel 15 Hauptamtlich Lehrende : Prof. Dr. Jüstel, Prof. Dr. Kynast, Dr. Stephanie Möller 16 Ergänzende Informationen / Literatur: 1. Vorlesungsskript (online) 2. G. Jander, K.F. Jahr (fortgeführt seit 1986 von G. Schulze, J. Simon) "Maßanalyse", W. de Gruyter 3. G. Jander, E. Blasius, Lehrbuch der analytischen und präparativen anorganischen Chemie, S. Hirzel Verlag 11
12 Mathematik 1 1 Modulbezeichnung / Title of Module Mathematik 1 (11300) 2 Modulturnus/regular: in SoSe/summer term, WiSe / winter term Veranstaltungssprache/n / Language Deutsch Weitere, nämlich: Prüfungs-Kennnummer (HIS-POS/LSF) Dauer des Moduls:/Duration: 1 Semester 2 Semester 3 Angebot für folgenden Studiengang/folgende Studiengänge Course of study: Pflicht, Wahl, Wahlpflicht Angebot im Fachsemester Bachelor Chemieingenieurwesen Pflicht 1 Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen Chemietechnik Pflicht Kontaktzeiten -inkl. Prüf. Contact times Selbststudium Self-study Lehrform Form of teaching SWS Std. pro Sem. SWS x i.d.r. 15 Semesterwochen Vorlesung / Lectures 4 60 Übung / Exercise 2 30 Praktikum / Lab course Form (z.b. Vor-/Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung, Ausarbeitung von Hausarbeiten, Recherche) Vor- und Nachbereitung der Vorlesungen und Übungen, Bearbeitung von Hausaufgaben und Prüfungsvorbereitung Std. pro Sem./ Hrs/semester 110 Summe Kontaktzeit 90 Std. Summe Selbststudium self-study total: 120 Std. 6 Arbeitsaufwand (Workload) 7 Lernergebnisse / Lernziele: Summe Kontaktzeit + Summe Selbststudium Leistungspunkte (i.d.r. 30 Std. = 1 LP) Credits 210 Std. 7 LP Die Studierenden verstehen die Grundbegriffe der Logik, den Zahlenaufbau; sie kennen wichtige reelle Funktionen einer Veränderlichen, die Differentialrechnung sowie verschiedene Methoden der Integralrechnung. Die Studierenden verstehen, wie man technische, naturwissenschaftliche und ökonomische Sachverhalte mathematisch beschreibt und löst. Sie können die so erlernten ingenieurmathematischen Grundlagen sowie einfache numerische Lösungsmethoden anwenden. Die Studierenden trainieren ganz allgemein die logischabstrakte Denkweise. Sie beherrschen das mathematische Rüstzeug für die späteren Anwendungen in Studium und Beruf. 12
13 8 Inhalt: Logik und Mengen: Klassische Aussagenlogik (Logische Operationen, Wahrheitstafeln, Normalformen; Umformung logischer Ausdrücke); Aussageformen (Allquantor, Existenzquantor); Elementare Mengenlehre (Menge und Teilmenge, Vereinigung und Durchschnitt, Komplement, Potenzmenge, Mengenalgebra) Zahlen und Folgen: Reeller Zahlenkörper (Aufbau des Zahlensystems, Rechengesetze, Prinzip der vollständigen Induktion); Summen, Produkte, elementare Kombinatorik (Umgang mit Summenzeichen und Produktzeichen, Fakultät und Permutationen, Binomialkoeffizienten und Kombinationen, binomischer Lehrsatz und Pascalsches Dreieck); Anordnung der reellen Zahlen (Positivität und Negativität; Absolutbetrag, Rechnen mit Ungleichungen und Beträgen); Zahlenfolgen (Beschränkte Folgen, monotone Folgen, Konvergenz und Grenzwert, Grenzwertsätze und Rechnen mit Grenzwerten, rekursive Folgen) Reelle Funktionen: Funktionen einer Veränderlichen (Definitions- und Wertebereich, Funktionsgraph, Komposition von Funktionen, Nullstellen, Polstellen, Asymptoten); Grenzwerte und Stetigkeit (Grenzwert und Übertragungsprinzip, Stetigkeit, Eigenschaften stetiger Funktionen, Zwischenwertsatz, Bisektion zur Nullstellenbestimmung, Umkehrfunktion, monotone Funktionen); wichtige elementare Funktionen (Exponential- und Logarithmusfunktion, Potenz- und Logarithmen Gesetze, trigonometrische Funktionen und deren Umkehrfunktionen, Grad- und Bogenmaß, Additionstheoreme und Beziehungen zwischen den Kreisfunktionen); Funktionen mehrerer Veränderlicher (Darstellungsarten, Stetigkeit in einem Punkt und in einem Gebiet, Stetigkeitseigenschaften) Differentialrechnung von Funktionen einer Veränderlichen: Differenzquotient und Differentialquotient (Ableitung und Tangente, lineare Approximation, Zusammenhang mit Stetigkeit), Rechenregeln (Linearität, Produkt-, Quotienten- und Kettenregel, Differentiation der Umkehrfunktion), Ableitung höherer Ordnung; Newton-Verfahren (Vielfachheit einer Nullstelle, Newton-Verfahren für einfache und m-fache Nullstellen; Mittelwertsatz und Taylorformel (Satz von Rolle und Mittelwertsatz, lokale Approximation und Taylorformel mit Restglied); Regel von l Hospital (Grenzwerte unbestimmter Ausdrücke); Kurvendiskussion (Lokale Extrema, Satz von Fermat, monotone Funktionen, konkave/konvexe Funktionen, Wendepunkte, globale Extrema) Integralrechnung: Bestimmtes Integral (Integrierbarkeit), Eigenschaften des Integrals (Linearität, Intervalladditivität, Mittelwertsatz), Integrabilität monotoner Funktionen und stetiger Funktionen; Fundamentalsätze ( Integralfunktion, Stammfunktion, Hauptsatz, unbestimmtes Integral); Integrationsmethoden (Grundintegrale, Partielle Integration, Substitution, Partialbruchzerlegung); Numerische Integration (Summierte Quadraturformeln, Rechteck-, Mittelpunkt-, Trapez- und Simpsonregel mit Fehlerbetrachtungen) 9 Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Immatrikulation 10 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Prüfung 11 Prüfungsformen und umfang: Klausur: 120 Minuten oder mündliche Prüfung 12 Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung: Immatrikulation und fristgerechte Online-Anmeldung über das LSF-Portal innerhalb des Anmeldezeitraums. 14 Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Pott-Langemeyer 13
14 15 Hauptamtlich Lehrender: Prof. Dr. Pott-Langemeyer 16 Ergänzende Informationen / Literatur: Manuskript: als Sammlung der Sätze und Definitionen verfügbar (pdf-file) Lothar Papula: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Band 1 bis 3; Albert Fetzer, Heiner Fränkel: Mathematik, Band 1 und 2; Ernst-Albrecht Reinsch: Mathematik für Chemiker; Teubner Taschenbuch der Mathematik; Hans-Jochen Bartsch: Taschenbuch mathematischer Formeln Thilo Arens: Mathematik 14
15 Technische Grundlagen 1 Modulbezeichnung / Title of Module Technische Grundlagen (11500) 2 Modulturnus/regular: in SoSe/summer term, WiSe / winter term Veranstaltungssprache/n / Language Deutsch Weitere, nämlich: Prüfungs-Kennnummer (HIS-POS/LSF) Dauer des Moduls:/Duration: 1 Semester 2 Semester 3 Angebot für folgenden Studiengang/folgende Studiengänge Pflicht, Wahl, Angebot im Course of study: Wahlpflicht Fachsemester Bachelor Chemieingenieurwesen Pflicht Kontaktzeiten -inkl. Prüf. Contact times Selbststudium Self-study Lehrform Form of teaching SWS Std. pro Sem. SWS x i.d.r. 15 Semesterwochen Vorlesung / Lectures 2 30 Übung / Exercise 1 15 Praktikum / Lab course Form (z.b. Vor-/Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung, Ausarbeitung von Hausarbeiten, Recherche) Vor- und Nachbereitung der Vorlesungen und Übungen, Prüfungsvorbereitung Std. pro Sem./ Hrs/semester 75 Summe Kontaktzeit 45 Std. Summe Selbststudium self-study total: 75 Std. 6 Arbeitsaufwand (Workload) 7 Lernergebnisse / Lernziele: Summe Kontaktzeit + Summe Selbststudium Leistungspunkte (i.d.r. 30 Std. = 1 LP) Credits 120 Std. 4 LP Die Studierenden verfügen über ein breites technisches Grundlagenwissen und können dadurch im Prinzip technische Lösungen chemisch-technischer Probleme entwickeln. 15
16 8 Inhalt: Beispiele ausgewählter Chemieanlagen, Apparate, wichtige Maschinen in der Chemie, Maschinenelemente wie Schrauben, Dichtungen, Wellen, Lager, Auswahl weiterer Maschinenelemente und deren zeichnerische Darstellung, Interpretation technischer Zeichnungen, Anfertigen eigener Handskizzen, Grundlagen der technischen Mechanik, Kräftebilanzen, Durchbiegung, Flächenträgheitsund Widerstandsmoment, Hookesches Gesetz, Festigkeitsberechnung. Technisches Zeichnen, d. h. Anfertigen ingenieurmäßiger Handskizzen 9 Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Immatrikulation Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Prüfung. Prüfungsformen und umfang: Klausur: 90 Minuten oder mündliche Prüfung Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung: Immatrikulation und fristgerechte Online-Anmeldung über das LSF-Portal innerhalb des Anmeldezeitraums Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Ebeling 15 Hauptamtlich Lehrender: Prof. Dr. Ebeling 16 Ergänzende Informationen / Literatur: Manuskript: verfügbar (Mutterkopie und Downloadversion) 16
17 Physik 1 Modulbezeichnung / Title of Module Physik Modulturnus/regular: in SoSe/summer term, WiSe / winter term Veranstaltungssprache/n / Language Deutsch Weitere, nämlich: Prüfungs-Kennnummer (HIS-POS/LSF) Dauer des Moduls:/Duration: 1 Semester 2 Semester 3 Angebot für folgenden Studiengang/folgende Studiengänge Course of study: Pflicht, Wahl, Wahlpflicht Angebot im Fachsemester Bachelor Chemieingenieurwesen Pflicht 1 Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen Chemietechnik Pflicht Kontaktzeiten -inkl. Prüf. Contact times Selbststudium Self-study Lehrform Form of teaching SWS Std. pro Sem. SWS x i.d.r. 15 Semesterwochen Vorlesung / Lectures 3 45 Übung / Exercise 2 30 Praktikum (Anwesenheitspflicht) Lab course(compulsory attendance) 2 30 Form (z.b. Vor-/Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung, Ausarbeitung von Hausarbeiten, Recherche) Vor- und Nachbereitung der Vorlesungen und Übungen, Nachbereitung des Praktikums, Prüfungsvorbereitung Std. pro Sem./ Hrs/semester 105 Summe Kontaktzeit 105 Std. Summe Selbststudium self-study total: 105Std. 6 Arbeitsaufwand (Workload) 7 Lernergebnisse / Lernziel: Summe Kontaktzeit + Summe Selbststudium Leistungspunkte (i.d.r. 30 Std. = 1 LP) Credits 210 Std. 7 LP Die Studierenden beherrschen die für Chemieingenieure wesentlichen Grundlagen und Methoden der Physik und wenden sie im Rahmen physikalischer Praktikumsversuche sicher an. 17
18 8 Inhalt: Mechanik der linearen Bewegungen, Kräfte, Energie, Leistung, Impuls Rotation, Drehimpuls, Schwingungen, Wellen Grundlagen der Hydrostatik und Hydrodynamik Optik, Brechung, geometrische Optik, Polarisation, Wellenoptik, opt. Instrumente Elektrostatik und Dynamik, Kräfte im E-Feld, Potenzial, Kapazität, Gleichstromkreise, magnetisches Feld, Kräfte im Magnetfeld, Faraday-Induktion Elektromagnetische Strahlung 9 Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Immatrikulation 10 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Prüfung und Anerkennung der Studienleistungen (erfolgreiche Teilnahme am Praktikum und schriftliche Ausarbeitungen und/oder mündliche Präsentationen zu den Praktikumsversuchen) durch Nachweis und Bekanntgabe an das Prüfungsamt. 11 Prüfungsformen und -umfang : Klausur (120 Minuten) oder mündliche Prüfung 12 Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung: Immatrikulation und fristgerechte Online-Anmeldung über das LSF-Portal innerhalb des Anmeldezeitraums Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Mertins (FB Physikalische Technik) 15 Hauptamtlich Lehrender: Prof. Dr. Mertins (FB Physikalische Technik) 16 Ergänzende Informationen / Literatur: Halliday-Resnick-Walker Physik Wiley VCH Verlag; Tippler, Physik Springerverlag Mertins, Gilbert Prüfungstrainer Experimentalphysik, Spektrum Akadem. Verlag Elsevier / Springerverlag Kuchling, Physik-Formelsammlung, Fachbuchverlag Leipzig 18
19 Organische Chemie 1 1 Modulbezeichnung / Title of Module Organische Chemie 1 (12100) 2 Modulturnus/regular: in SoSe/summer term, WiSe / winter term Veranstaltungssprache/n / Language Deutsch Weitere, nämlich: Prüfungs-Kennnummer (HIS-POS/LSF) Dauer des Moduls:/Duration: 1 Semester 2 Semester 3 Angebot für folgenden Studiengang/folgende Studiengänge Course of study: Pflicht, Wahl, Wahlpflicht Angebot im Fachsemester Bachelor Chemieingenieurwesen Pflicht 2 Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen Chemietechnik Pflicht Kontaktzeiten -inkl. Prüf. Contact times Selbststudium Self-study Lehrform Form of teaching SWS Std. pro Sem. SWS x i.d.r. 15 Semesterwochen Vorlesung / Lectures 3 45 Übung / Exercise 1 15 Praktikum (Anwesenheitspflicht) Lab course(compulsory attendance) 2 30 Form (z.b. Vor-/Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung, Ausarbeitung von Hausarbeiten, Recherche) Vor- und Nachbereitung der Vorlesungen und Übungen, Nachbereitung des Praktikums, Prüfungsvorbereitung Std. pro Sem./ Hrs/semester 90 Summe Kontaktzeit 90 Std. Summe Selbststudium self-study total: 90 Std. 6 Arbeitsaufwand (Workload) 7 Lernergebnisse / Lernziele : Summe Kontaktzeit + Summe Selbststudium Leistungspunkte (i.d.r. 30 Std. = 1 LP) Credits 180 Std. 6 LP Die Studierenden kennen die elementaren Mechanismen der Organischen Chemie und können diese formal korrekt darstellen. Nach erfolgreichem Abschluss besitzen sie eine breite Fachkompetenz auf dem Gebiet organisch-chemischer Mechanismen und wenden diese Kenntnisse sicher an. Die Studierenden haben sich erste Fähigkeiten zur analytisch-wissenschaftlichen Problemlösung angeeignet und können mit Hilfe der erworbenen Basiskenntnisse zur Reaktivität funktioneller Gruppen neue Fragestellungen bearbeiten und selbstständig Lösungsansätze entwickeln. Die Studierenden sind in der Lage einfache Reaktionsapparaturen handwerklich und sicherheitstechnisch korrekt aufzubauen und zu bedienen. Sie können nach vorgegebenen Rezepturen einfache Präparate herstellen und ihre Qualität analytisch beurteilen. 19
20 8 Inhalt: Substitutionen, Additionen, Eliminierungen; jeweils nukleophil, elektrophil, radikalisch werden an diversen Beispielen vorgestellt. Training der analytischen Problemlösungskompetenz in der Org. Chemie anhand von Übungsbeispielen. Praktikum: Aufbau von Laborapparaturen, Grundoperationen (Rührapparatur, Destillieren, Kristallisieren, ), Analytische Reinheitsbestimmung, Erstellen eines Laborberichtes/Laborjournals 9 Voraussetzungen für die Teilnahme am Praktikum und am Modul: Die Inhalte der Module Allgemeine Chemie und Analytische Chemie werden vorausgesetzt. Immatrikulation 10 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Prüfung und Anerkennung der Studienleistungen (erfolgreiche Teilnahme am Praktikum und Anfertigung der Versuchsprotokolle und Teilnahme an Pflichtkolloquien sowie schriftliche Ausarbeitungen und/oder mündliche Präsentationen zu den Praktikumsversuchen) durch Nachweis und Bekanntgabe an das Prüfungsamt. 11 Prüfungsformen und umfang: Klausur (120 Minuten) oder mündliche Prüfung 12 Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung: Immatrikulation und fristgerechte Online-Anmeldung über das LSF-Portal innerhalb des Anmeldezeitraums Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Weiper-Idelmann 15 Hauptamtlich Lehrende: Prof. Dr. Weiper-Idelmann, Prof. Dr. Schupp 16 Ergänzende Informationen / Literatur: P. Sykes: Wie funktionieren organische Reaktionen; VCH K.P.C. Vollhardt, N.E. Shore: Organische Chemie, VCH Beyer H, Walter W: Organische Chemie, S. Hirzel Verlag, Stuttgart P.Y. Bruice: Organische Chemie, Pearson Studium 20
21 Anorganische Chemie 1 1 Modulbezeichnung / Title of Module Anorganische Chemie 1 (12200) 2 Modulturnus/regular: in SoSe/summer term, WiSe / winter term Veranstaltungssprache/n / Language Deutsch Weitere, nämlich: Prüfungs-Kennnummer (HIS-POS/LSF) Dauer des Moduls:/Duration: 1 Semester 2 Semester 3 Angebot für folgenden Studiengang/folgende Studiengänge Course of study: Pflicht, Wahl, Wahlpflicht Angebot im Fachsemester Bachelor Chemieingenieurwesen Pflicht 2 Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen Chemietechnik Pflicht Kontaktzeiten -inkl. Prüf. Contact times Selbststudium Self-study Lehrform Form of teaching SWS Std. pro Sem. SWS x i.d.r. 15 Semesterwochen Vorlesung / Lectures 3 45 Übung / Exercise 1 15 Praktikum (Anwesenheitspflicht) Lab course(compulsory attendance) 3 45 Form (z.b. Vor-/Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung, Ausarbeitung von Hausarbeiten, Recherche) Vor- und Nachbereitung der Vorlesungen und Übungen, Nachbereitung des Praktikums, Prüfungsvorbereitung Std. pro Sem./ Hrs/semester 105 Summe Kontaktzeit 105 Std. Summe Selbststudium self-study total: 105 Std. 6 Arbeitsaufwand (Workload) 7 Lernergebnisse / Lernziele: Summe Kontaktzeit + Summe Selbststudium Leistungspunkte (i.d.r. 30 Std. = 1 LP) Credits 210 Std. 7 LP Die Studierenden erkennen die Bindungskonzepte als primäres Ordnungsprinzip in der (anorganischen) Chemie und können darauf aufbauend die mannigfaltigen stofflichen Phänomene erklären. Sie wenden die grundlegenden Prinzipien auf ausgewählte, technisch relevante Stoffe an. s. auch Anorganische Chemie 2. 21
22 8 Inhalt: Ionische, kovalente, metallische Bindung: Elektronegativität, ionischer und kovalenter Bindungsanteil, Metallcharakter VB-, VSEPR-Methode: Koordinationspolyeder, (Geometrien von Wasserstoff-) Orbitalen, gerichtete Bindung bei Koordinationszahlen eins bis acht, Resonanz, Defizite der VB-Methode MO-Methode: Delokalisation, bindende / antibindende Orbitale, Paramagnetismus von Sauerstoff und den Monostickstoffoxiden, Korrelationsdiagramme homonuklearer und heteronuklearer, zweiatomiger und dreiatomiger Moleküle, Separation von σ- und π-bindungen in polyatomigen Molekülen, Beschränkungen Festkörper: Packungen in Metallen, ionische Festkörper, Radien Verhältnisse, Kristallsysteme, elementare (ionische) Kristallstrukturen, Madelung-Konstante, Born-Landé-Gleichung, Kreisprozesse, Gitterenergie, kovalente Festkörper, Bändermodell, Halbleiter, Schichtengitter, Kettengitter, Molekülgitter, Punktgitter Technische Prozesse: Haber-Bosch-Verfahren, Schwefelsäure-, Salpetersäureherstellung, Müller-Rochow-Verfahren, Chloralkali- Elektrolyse Hauptgruppenelemente Einführung in die Stoffchemie Praktikum: Im Praktikum des 2. Semesters steht im Mittelpunkt die "klassische" qualitative anorganische Analytik mit den erforderlichen, grundlegenden Stoffkenntnissen, erweitert um Entsorgungsprozeduren für anfallende problematische Abfälle. Die Studierenden des Wirtschaftsingenieurwesens werden zudem mittels zweier Präparate, die auch analysiert und charakterisiert werden, in die anorganische Synthese eingeführt. 9 Voraussetzungen für die Teilnahme am Praktikum und am Modul: Die Inhalte der Module Allgemeine Chemie und Analytische Chemie werden vorausgesetzt. Immatrikulation 10 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Prüfung und Anerkennung der Studienleistungen (erfolgreiche Teilnahme am Praktikum und Anfertigung der Versuchsprotokolle, schriftliche Ausarbeitungen und/oder mündliche Präsentationen zu den Praktikumsversuchen) durch Nachweis und Bekanntgabe an das Prüfungsamt. 11 Prüfungsformen und umfang: Klausur (180 Minuten) oder mündliche Prüfung. 12 Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung : Immatrikulation und fristgerechte Online-Anmeldung über das LSF-Portal innerhalb des Anmeldezeitraums. 14 Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Jüstel 15 Hauptamtlich Lehrende: Prof. Dr. Jüstel, Prof. Dr. Kynast 16 Ergänzende Informationen / Literatur: 1. Vorlesungsskript (online) 2. E. Riedel "Anorganische Chemie", W. de Gruyter, 3. M. Binnewies Allgemeine und Anorg. Chemie, Spektrum-Verlag 4. G. Jander, E. Blasius, Lehrbuch der analytischen und präparativen anorganischen Chemie, S. Hirzel Verlag 22
23 Physikalische Chemie 1 1 Modulbezeichnung / Title of Module Physikalische Chemie 1 (12300) 2 Modulturnus/regular: in SoSe/summer term, WiSe / winter term Veranstaltungssprache/n / Language Deutsch Weitere, nämlich: Prüfungs-Kennnummer (HIS-POS/LSF) Dauer des Moduls:/Duration: 1 Semester 2 Semester 3 Angebot für folgenden Studiengang/folgende Studiengänge Course of study: Pflicht, Wahl, Wahlpflicht Angebot im Fachsemester Bachelor Chemieingenieurwesen Pflicht 2 Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen Chemietechnik Pflicht Kontaktzeiten -inkl. Prüf. Contact times Selbststudium Self-study Lehrform Form of teaching SWS Std. pro Sem. SWS x i.d.r. 15 Semesterwochen Vorlesung / Lectures 3 45 Übung / Exercise 1 15 Praktikum (Anwesenheitspflicht) Lab course(compulsory attendance) 2 30 Form (z.b. Vor-/Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung, Ausarbeitung von Hausarbeiten, Recherche) Vor- und Nachbereitung der Vorlesungen und Übungen, Nachbereitung des Praktikums, Prüfungsvorbereitung, Std. pro Sem./ Hrs/semester 90 Summe Kontaktzeit 90 Std. Summe Selbst- Studium self-study total: 90 Std. 6 Arbeitsaufwand (Workload) 7 Lernergebnisse / Lernziele: Summe Kontaktzeit + Summe Selbststudium Leistungspunkte (i.d.r. 30 Std. = 1 LP) Credits 180 Std. 6 LP Die Studierenden verstehen die elementaren Konzepte der chemischen Thermodynamik und können das Verhalten realer Gase interpretieren. Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage, chemische Prozessgrößen (Reaktionsenthalpie, Reaktionsentropie und daraus abgeleitete Größen) zu benutzen, aus standardisierten Daten temperaturabhängig zu berechnen und mit Hilfe der Fundamentalgleichungen der Thermodynamik miteinander in Beziehung zu setzen. 23
24 8 Inhalt: Reale Gase: Beschreibung des realen Verhaltens durch Kompressionsfaktor, Virialgleichungen, van-der-waals-gleichung. Kondensation der Gase, kritischer Punkt und van-der-waals-gleichung. Erster Hauptsatz der Thermodynamik: Abgeschlossene Systeme, geschlossene Systeme, Volumenarbeit, differentielle Darstellung, reversible und irreversible Prozesse, P/V-Diagramme, Wärmekapazität, Zustandsfunktionen, Wegfunktionen, vollständige Differentiale, Enthalpie, isobare Prozesse, adiabatische Prozesse, adiabatische Zustandsgleichung, Joule- Thomson-Prozess, thermochemische Größen für Phasenübergänge, Prozess- und Reaktionsenthalpien, Standardzustände, Bildungsenthalpie, Kreisprozesse, Satz von Kirchhoff. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik: Freiwillige und unfreiwillige Prozesse, Entropieproduktion, Zusammenhang zwischen Wärme und Entropie, reversibler Wärmeübergang, Carnot-Prozess, Wärmediagramm, Wirkungsgrade von Wärmekraftmaschinen, Kühlmaschinen, Wärmepumpen, Entropieänderung bei der Expansion des idealen Gases, Entropieänderungen bei Phasenübergängen, Temperaturabhängigkeit der Entropie. Dritter Hauptsatz der Thermodynamik: Absoluter Nullpunkt der Temperatur, Nullpunkt der Entropie, Standardentropien, Restentropie. Gleichgewichtsbedingungen und Fundamentalgleichungen: Freie Enthalpie, freie Energie, Gleichgewicht im isobaren und isothermen System, Gleichgewicht im isochoren und isothermen System, maximal mögliche Arbeit, maximal mögliche Nicht-Volumenarbeit, Fundamentalgleichungen der Thermodynamik, Gibbs-Helmholtz-Gleichung, Maxwell-Gleichungen, thermodynamische Zustandsgleichungen, Differenz zwischen Cp und Cv, Druckabhängigkeit von Cp, Volumenabhängigkeit von Cv. Praktikum (Anwesenheitspflicht): Im Praktikum stehen vorbereitete Experimente zur Verfügung, die die Grundlagen der chemischen Thermodynamik reflektieren (isobare Reaktionskalorimetrie, isochore Verbrennungskalorimetrie, Phasengleichgewichte, elementare Elektrochemie). Das Praktikum wird in Gruppen durchgeführt. 9 Voraussetzungen für die Teilnahme am Praktikum Physikalische Chemie 1: Erfolgreiche Teilnahme am Praktikum Analytische Chemie. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Die Inhalte der Module Allgemeine Chemie, Mathematik I und Physik werden vorausgesetzt. Immatrikulation. 10 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Prüfung und Anerkennung der Studienleistungen (erfolgreiche Teilnahme am Praktikum und Anfertigung der Versuchsprotokolle, schriftliche Ausarbeitungen und/oder mündliche Präsentationen zu den Praktikumsversuchen) durch Nachweis und Bekanntgabe an das Prüfungsamt. 11 Prüfungsformen und umfang: Klausur (120 Minuten) oder mündliche Prüfung 12 Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung: Immatrikulation und fristgerechte Online-Anmeldung über das LSF-Portal innerhalb des Anmeldezeitraums Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Bredol 15 Hauptamtlich Lehrende: Prof. Dr. Bredol, Prof. Dr. Schlitter 16 Ergänzende Informationen / Literatur: 1. Vorlesungsskript (teils elektronisch bereitgestellt) 2. Atkins: Physikalische Chemie 3. Wedler: Lehrbuch der Physikalischen Chemie 4. Versuchsanleitungen zu den Praktikumsversuchen 24
25 Mathematik 2 1 Modulbezeichnung / Title of Module Mathematik 2 (12400) 2 Modulturnus/regular: in SoSe/summer term, WiSe / winter term Veranstaltungssprache/n / Language Deutsch Weitere, nämlich: Prüfungs-Kennnummer (HIS-POS/LSF) Dauer des Moduls:/Duration: 1 Semester 2 Semester 3 Angebot für folgenden Studiengang/folgende Studiengänge Course of study: Pflicht, Wahl, Wahlpflicht Angebot im Fachsemester Bachelor Chemieingenieurwesen Pflicht 2 Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen Chemietechnik Pflicht 2 4 Kontaktzeiten -inkl. Prüf. Contact times Lehrform Form of teaching SWS Std. pro Sem. SWS x i.d.r. 15 Semesterwochen Vorlesung / Lectures 4 60 Übung / Exercise 2 30 Summe Kontaktzeit Praktikum /lab course Std. 5 Selbststudium Self-study Form (z.b. Vor-/Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung, Ausarbeitung von Hausarbeiten, Recherche) Vor und Nachbereitung der Vorlesungen und Übungen, Bearbeitung von Hausaufgaben, Prüfungsvorbereitung Std. pro Sem./ Hrs./semester 90 Summe Selbst- Studium self-study total: 90 Std. 6 Arbeitsaufwand (Workload) 7 Lernergebnisse / Lernziele: Summe Kontaktzeit + Summe Selbststudium Leistungspunkte (i.d.r. 30 Std. = 1 LP) Credits 180 Std. 6 LP Die Studierenden sind vertraut mit den Methoden der linearen Algebra, der Differentialrechnung von Funktionen mehrerer Veränderlicher, mathematischen Reihen und Potenzreihenansätzen, der Lösung von gewöhnlichen Differentialgleichungen sowie den Methoden der Interpolation und Approximation. Die Studierenden können technische, naturwissenschaftliche und ökonomische Sachverhalte mathematisch beschreiben und die daraus resultierenden mathematischen Probleme lösen. Die Studierenden trainieren ganz allgemein die logischabstrakte Denkweise. Sie abstrahieren und denken in Zusammenhängen. Sie wenden das hier Gelernte im weiteren Verlauf des Studiums und später im Beruf an insbesondere auch Methoden der numerischen Mathematik. 25
26 8 Inhalt: Lineare Algebra und analytische Geometrie: Vektorräume (Basis und Dimension, Skalarprodukt, Distanz und Norm); Analytische Geometrie (Winkel-, Vektor- und Kreuzprodukt, Spatprodukt, Geraden- und Ebenendarstellungen); Matrizenalgebra (Matrizenkalkül, transponierte Matrix, Rang, Invertierung, reguläre und singuläre Matrizen) Differentialrechnung von Funktionen mehrerer Veränderlicher Ableitungen (partielle Ableitung und Richtungsableitung, totales Differential und Tangentialebene, partielle Ableitungen höherer Ordnung, Satz von Schwarz über gemischte Ableitungen); Extrema (stationäre Punkte, Hessematrix, lokale Extrema und Sattelpunkte) Reihen Reihen mit konstanten Gliedern (Partialsummen und Konvergenz, Leibnitzkriterium für alternierende Reihen, absolute Konvergenz), Konvergenzkriterien (Quotienten- und Wurzelkriterium, Majoranten- und Minorantenkriterium), geometrische Reihen, harmonische Reihen, Teleskopreihen; Potenzreihen (Koeffizienten und Entwicklungspunkt; Rechenregeln, Konvergenzradius, gliedweise Differentiation und Integration, Taylorreihe, Weierstraßscher Approximationssatz) Gewöhnliche Differentialgleichungen Differentialgleichungen 1. Ordnung (Anfangswertproblem), Existenz- und Eindeutigkeitssatz, Lösungsmethoden (Separation, lineare Substitution, Ähnlichkeits-Differentialgleichung, lineare Differentialgleichung, Potentialfunktion und exakte Differentialgleichung); Differentialgleichungen höherer Ordnung (lineare DGL s n- ter Ordnung, Fundamentalsystem, Lineare DGL s mit konstanten Koeffizienten und charakteristisches Polynom, Variation der Konstanten und spezielle Ansätze, Potenzreihenansatz); Numerische Lösungsverfahren (Linienelement und Richtungsfeld, Verfahren von Euler-Cauchy, Heun und Runge-Kutta) Interpolation und Approximation Algebraische Interpolation (Existenz- und Eindeutigkeitssatz, Newton-Interpolation, Restglied bei algebraischer Interpolation); Spline-Interpolation (kubische Splines); Ausgleichsrechnung (Fehlermaße, Approximationsaufgabe, diskrete Gaußsche Fehlerquadratmethode, lineare Regression). 9 Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Kenntnisse der Inhalte, wie sie in Mathematik I vermittelt werden, werden vorausgesetzt. Immatrikulation 10 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Prüfung 11 Prüfungsformen und -umfang : Klausur (120 Minuten) oder mündliche Prüfung 12 Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung : Immatrikulation und fristgerechte Online-Anmeldung über das LSF-Portal innerhalb des Anmeldezeitraums Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Pott-Langemeyer 15 Hauptamtlich Lehrender: Prof. Dr. Pott-Langemeyer 16 Ergänzende Informationen / Literatur: Lothar Papula: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Band 1 bis 3; Albert Fetzer, Heiner Fränkel: Mathematik, Band 1 und 2; Ernst-Albrecht Reinsch: Mathematik für Chemiker; Teubner Taschenbuch der Mathematik; Hans-Jochen Bartsch: Taschenbuch mathematischer Formeln Tilo Arens u.a.: Mathematik 26
27 Apparate und Prozesse 1 Modulbezeichnung / Title of Module Apparate und Prozesse (12500) 2 Modulturnus/regular: in SoSe/summer term, WiSe / winter term Veranstaltungssprache/n / Language Deutsch Weitere, nämlich: Prüfungs-Kennnummer (HIS-POS/LSF) Dauer des Moduls:/Duration: 1 Semester 2 Semester 3 Angebot für folgenden Studiengang/folgende Studiengänge Pflicht, Wahl, Angebot im Course of study: Wahlpflicht Fachsemester Bachelor Chemieingenieurwesen Pflicht Kontaktzeiten -inkl. Prüf. Contact times Selbststudium Self-study Lehrform Form of teaching SWS Std. pro Sem. SWS x i.d.r. 15 Semesterwochen Vorlesung / Lectures 3 45 Übung / Exercise 1 15 Praktikum (Anwesenheitspflicht) Lab course(compulsory attendance) 1 15 Form (z.b. Vor-/Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung, Ausarbeitung von Hausarbeiten, Recherche) Vor- und Nachbereitung der Vorlesungen und Übungen, Nachbereitung des Praktikums, Prüfungsvorbereitung Std. pro Sem./ Hrs./semester 75 Summe Kontaktzeit 75 Std. Summe Selbst- Studium self-study total: 75 Std. 6 Arbeitsaufwand (Workload) 7 Lernergebnisse / Lernziele: Summe Kontaktzeit + Summe Selbststudium Leistungspunkte (i.d.r. 30 Std. = 1 LP) Credits 150 Std. 5 LP Die Studierenden sind mit verfahrenstechnischen Anlagen und Prozessen sowie mit den wichtigsten Komponenten einer Chemieanlage vertraut. Sie verstehen die Prozesse und sind in der Lage, für die üblichen Anwendungsfälle Behälter, Pumpen und Rohrleitungen hinsichtlich ihrer Schlüsseldaten auszulegen. 27
28 8 Inhalt: Anlagen und Verfahrenstechnik Definition, Beispiele für Prozesse, Fließbilder, Rohrleitungs- und Instrumentierungs-schemata, Bilanzen Apparatekunde: Komponenten: Behälter (Auslegung, AD-Merkblätter), Rohrleitungen, Normen, Armaturen, Kompensatoren und weiteres Zubehör, Strömungsmechanik und Druckverlust in Rohrleitungen, Gleichung von Bernoulli, Kreiselpumpen (Chemienormpumpen), Auslegung, Förderhöhe, NPSH-Wert, Konstruktive Gesichtspunkte, Spezialpumpen, Dickstoffpumpen, Hochdruckpumpen, Kobenpumpen, Membranpumpen, Peristaltik-pumpen, Ventiloren, Gebläse, Verdichter, verschiedene Bauarten, mechanische Förderelemente, insb. Elevatoren und Trogkettenförderer, pneumatische Förderer, insb. "Pumpen" und Druckgefäßförderer, elektrische Antriebe, Asynchronmotoren, Getriebe, Wärmeaustauscher, weitere wichtige Apparate und Maschinen in der Chemie (Grobübersicht) Praktikum Druckverlust in Rohrleitungen und Einzelhindernissen (Blende), Pumpenprüfstand, Ausbildung an Modellen 9 Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Kenntnisse der Inhalte des Moduls Technische Grundlagen. Immatrikulation. 10 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Prüfung und Anerkennung der Studienleistungen (erfolgreiche Teilnahme am Praktikum und Anfertigung der Versuchsprotokolle, schriftliche Ausarbeitungen und/oder mündliche Präsentationen zu den Praktikumsversuchen) durch Nachweis und Bekanntgabe an das Prüfungsamt. 11 Prüfungsformen und umfang: Klausur (120 Minuten) oder mündliche Prüfung 12 Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung: Immatrikulation und fristgerechte Online-Anmeldung über das LSF-Portal innerhalb des Anmeldezeitraums Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Ebeling 15 Hauptamtlich Lehrender: Prof. Dr. Ebeling 16 Ergänzende Informationen / Literatur: Manuskripte 28
29 Organische Chemie 2 1 Modulbezeichnung / Title of Module Organische Chemie 2 (13110) 2 Modulturnus/regular: in SoSe/summer term, WiSe / winter term Veranstaltungssprache/n / Language Deutsch Weitere, nämlich: Prüfungs-Kennnummer (HIS-POS/LSF) Dauer des Moduls:/Duration: 1 Semester 2 Semester 3 Angebot für folgenden Studiengang/folgende Studiengänge Course of study: Pflicht, Wahl, Wahlpflicht Angebot im Fachsemester Bachelor Chemieingenieurwesen Pflicht 3 Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen Chemietechnik Pflicht Kontaktzeiten -inkl. Prüf. Contact times Selbststudium Self-study Lehrform Form of teaching SWS Std. pro Sem. SWS x i.d.r. 15 Semesterwochen Vorlesung / Lectures 3 45 Übung / Exercise 1 15 Praktikum (Anwesenheitspflicht) Lab course(compulsory attendance) Form (z.b. Vor-/Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung, Ausarbeitung von Hausarbeiten, Recherche) Vor- und Nachbereitung der Vorlesungen und Übungen, Nachbereitung des Praktikums, Prüfungsvorbereitung 4 60 Std. pro Sem./ Hrs/semester 120 Summe Selbststudium self-study total: Summe Kontaktzeit 120 Std. 120 Std. 6 Arbeitsaufwand (Workload) 7 Lernergebnisse / Lernziele: Summe Kontaktzeit + Summe Selbststudium Leistungspunkte (i.d.r. 30 Std. = 1 LP) Credits 240 Std. 8 LP Die Studierenden kennen die wichtigsten Eigenschaften und Reaktionen ausgewählter funktioneller Gruppen sowie die Möglichkeiten zur Herstellung dieser Gruppen. Auf der Basis dieser Kenntnisse sind die Studierenden in der Lage, die Synthese einfacher Verbindungen zu planen. Praktikum: Die Studierenden haben ihr experimentelles Geschick sowohl für die Synthese, als auch zur analytischen Charakterisierung von organischen Substanzen vertieft und sie beherrschen die experimentellen Grundoperationen der organischen Synthese. 29
30 8 Inhalt: Eigenschaften, Reaktionen und Synthesen der: Alkane, Alkene, Alkine; Cycloalkane; Halogenalkane; Alkohole; Aldehyde und Ketone; Carbonsäuren. Statische Stereochemie. Praktikum: Durchführung von: Veresterung, Aldolreaktion, -kondensation, Umpolungsreaktion, Azokupplung, Redoxreaktion Analysemethoden: IR-Spektroskopie, Siedepunkt-, Schmelzpunktbestimmung 9 Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul und am Praktikum Organische Chemie 2: Bestandenes Modul Allgemeine Chemie und erfolgreiche Teilnahme am Praktikum Organische Chemie 1. Immatrikulation. 10 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Prüfung und Anerkennung der Studienleistungen (erfolgreiche Teilnahme am Praktikum und Anfertigung der Versuchsprotokolle, schriftliche Ausarbeitungen und/oder mündliche Präsentationen zu den Praktikumsversuchen) durch Nachweis und Bekanntgabe an das Prüfungsamt. 11 Prüfungsformen und umfang: Klausur (180 Minuten) oder mündliche Prüfung. 12 Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung: Immatrikulation und fristgerechte Online-Anmeldung über das LSF-Portal innerhalb des Anmeldezeitraums Modulverantwortlicher: Prof. Weiper-Idelmann 15 Hauptamtlich Lehrende: Prof. Dr. Weiper-Idelmann, Prof. Dr. Schupp 16 Ergänzende Informationen / Literatur: K.P.C. Vollhardt, N.E. Shore: Organische Chemie, VCH P.Y. Bruice: Organische Chemie, Pearson Studium 30
31 Physikalische Chemie 2 1 Modulbezeichnung / Title of Module Physikalische Chemie 2 (13210) 2 Modulturnus/regular: in SoSe/summer term, WiSe / winter term Veranstaltungssprache/n / Language Deutsch Weitere, nämlich: Prüfungs-Kennnummer (HIS-POS/LSF) Dauer des Moduls:/Duration: 1 Semester 2 Semester 3 Angebot für folgenden Studiengang/folgende Studiengänge Course of study: Pflicht, Wahl, Wahlpflicht Angebot im Fachsemester Bachelor Chemieingenieurwesen Pflicht 3 Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen Chemietechnik Pflicht Kontaktzeiten -inkl. Prüf. Contact times Selbststudium Self-study Lehrform Form of teaching SWS Std. pro Sem. SWS x i.d.r. 15 Semesterwochen Vorlesung / Lectures 3 45 Übung / Exercise 2 30 Praktikum (Anwesenheitspflicht) Lab course(compulsory attendance) 2 30 Form (z.b. Vor-/Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung, Ausarbeitung von Hausarbeiten, Recherche) Vor- und Nachbereitung der Vorlesungen und Übungen, Nachbereitung des Praktikums, Prüfungsvorbereitung Std. pro Sem./ Hrs/semester 105 Summe Kontaktzeit 105 Std. Summe Selbststudium self-study total: 105 Std. 6 Arbeitsaufwand (Workload) 7 Lernergebnisse / Lernziele: Summe Kontaktzeit + Summe Selbststudium Leistungspunkte (i.d.r. 30 Std. = 1 LP) Credits 210 Std. 7 LP Die Studierenden sind vertraut mit der Behandlung physikalischer und chemischer Gleichgewichte sowie mit elementaren Konzepten der Reaktionskinetik. Sie sind in der Lage, entsprechende Gleichgewichte zu analysieren und Gleichgewichtskonstanten aus thermodynamischen Daten temperaturabhängig zu berechnen, einschließlich elektrochemischer Probleme. Weiterhin beherrschen sie den Umgang mit chemischen Potenzialen, Mischungsgrößen und Phasendiagrammen. Die Studierenden sind in der Lage, Im Rahmen der Reaktionskinetik mit Elementarreaktionen umzugehen und sie zu (einfachen) Reaktionsmechanismen zu koppeln. 31
32 8 Inhalt: Physikalische Gleichgewichte: Dampfdruckkurven berechnet nach Clausius und Clapeyron, Gleichungen nach August und Antoine, Verdampfungsenthalpien, chemisches Potenzial und chemische Arbeit, Druck- und Temperaturabhängigkeit der Standardpotenziale, Aktivitäten, Gleichgewichtsbedingungen, Gibbs sche Phasenregel, ideale Mischungen, Dampfdruck idealer Mischungen, Dampfdruck realer Mischungen, Gleichung von Gibbs und Duhem, Siedekurve und Kondensationskurve, azeotrope Punkte, fraktionierte Destillation und Rektifikation. Ideal verdünnte Lösungen: Siedepunktserhöhung, Gefrierpunktserniedrigung und osmotischer Druck. Schmelzdiagramme: Eutektische Systeme, Mischkristallbildung, peritektische Systeme, Fe/C-Diagramm. Chemische Gleichgewichte: Beiträge von Mischungsentropie und Reaktionsenthalpie in homogenen Reaktionssystemen, Reaktionskoordinate, Freie-Enthalpie-Kurven, Freie Reaktionsenthalpie, Reaktionsquotient, Massenwirkungsgesetz, Temperaturabhängigkeit der Gleichgewichtskonstanten, Druckabhängigkeit der Gleichgewichtskonstanten, Verschiebung von Gleichgewichten, Einfluss von Aktivitätskoeffizienten, Grundlagen der Theorie von Debye und Hückel, Dissoziationsgleichgewichte in starken und schwachen Säuren und Basen, heterogene Reaktionssysteme: Zersetzung und Löslichkeit von Feststoffen, elektrisches Potenzial und elektrochemische Gleichgewichte, Prozesse auf Elektrodenoberflächen, elektrochemisches Potenzial, elektrochemische Ketten, galvanische Zellen, elektrolytische Zellen, Konzentrationsketten, Brennstoffzellen. Reaktionskinetik: Definition und Messung der Reaktionsgeschwindigkeit, Geschwindigkeitsgesetze, Bedeutung von k, Reaktionsordnung, Reaktionen erster und zweiter Ordnung, Folge- und Parallelreaktion, Temperaturabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit, theoretische Aspekte der Reaktionskinetik: Elementarreaktionen, geschwindigkeitsbestimmender Schritt, Quasistationarität. Praktikum (Anwesenheitspflicht): Im Praktikum stehen vorbereitete Experimente zur Verfügung, die die Grundlagen der physikalischen und chemischen Gleichgewichtsthermodynamik thematisieren (u.a. Gefrierpunktserniedrigung, Phasendiagramme, Rektifikation, Ostwald sches Verdünnungsgesetz, Esterverseifung). Das Praktikum wird in Gruppen durchgeführt. Der Teilnahmenachweis wird erteilt, wenn zu allen Experimenten Berichte vorliegen und die abschließende gemeinsame Auswertungsveranstaltung erfolgreich absolviert worden ist. 9 Voraussetzungen für die Teilnahme am Praktikum Physikalische Chemie 2: Erfolgreiche Teilnahme am Praktikum Analytische Chemie. Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Die Inhalte der Module Physikalische Chemie 1, Allgemeine Chemie, Mathematik, Physik werden vorausgesetzt. Immatrikulation. 10 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Bestehen der Prüfung und Anerkennung der Studienleistungen (erfolgreiche Teilnahme am Praktikum und Anfertigung der Versuchsprotokolle, schriftliche Ausarbeitungen und/oder mündliche Präsentationen zu den Praktikumsversuchen) durch Nachweis und Bekanntgabe an das Prüfungsamt. 11 Prüfungsformen und umfang: Klausur (120 Minuten) oder mündliche Prüfung. 12 Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung: Immatrikulation und fristgerechte Online-Anmeldung über das LSF-Portal innerhalb des Anmeldezeitraums. 14 Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Bredol 15 Hauptamtlich Lehrende: Prof. Dr. Bredol, Prof. Dr. Schlitter 16 Ergänzende Informationen / Literatur: 1. Vorlesungsskript (teils elektronisch bereitgestellt) 2. Atkins: Physikalische Chemie 3. Wedler: Lehrbuch der Physikalischen Chemie 32
Inhalt 1 Grundlagen der Thermodynamik
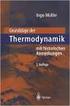 Inhalt 1 Grundlagen der Thermodynamik..................... 1 1.1 Grundbegriffe.............................. 2 1.1.1 Das System........................... 2 1.1.2 Zustandsgrößen........................
Inhalt 1 Grundlagen der Thermodynamik..................... 1 1.1 Grundbegriffe.............................. 2 1.1.1 Das System........................... 2 1.1.2 Zustandsgrößen........................
Mathematik anschaulich dargestellt
 Peter Dörsam Mathematik anschaulich dargestellt für Studierende der Wirtschaftswissenschaften 15. überarbeitete Auflage mit zahlreichen Abbildungen PD-Verlag Heidenau Inhaltsverzeichnis 1 Lineare Algebra
Peter Dörsam Mathematik anschaulich dargestellt für Studierende der Wirtschaftswissenschaften 15. überarbeitete Auflage mit zahlreichen Abbildungen PD-Verlag Heidenau Inhaltsverzeichnis 1 Lineare Algebra
Inhaltsverzeichnis. Vorwort Kapitel 1 Einführung, I: Algebra Kapitel 2 Einführung, II: Gleichungen... 57
 Vorwort... 13 Vorwort zur 3. deutschen Auflage... 17 Kapitel 1 Einführung, I: Algebra... 19 1.1 Die reellen Zahlen... 20 1.2 Ganzzahlige Potenzen... 23 1.3 Regeln der Algebra... 29 1.4 Brüche... 34 1.5
Vorwort... 13 Vorwort zur 3. deutschen Auflage... 17 Kapitel 1 Einführung, I: Algebra... 19 1.1 Die reellen Zahlen... 20 1.2 Ganzzahlige Potenzen... 23 1.3 Regeln der Algebra... 29 1.4 Brüche... 34 1.5
Großes Lehrbuch der Mathematik für Ökonomen
 Großes Lehrbuch der Mathematik für Ökonomen Von Professor Dr. Karl Bosch o. Professor für angewandte Mathematik und Statistik an der Universität Stuttgart-Hohenheim und Professor Dr. Uwe Jensen R. Oldenbourg
Großes Lehrbuch der Mathematik für Ökonomen Von Professor Dr. Karl Bosch o. Professor für angewandte Mathematik und Statistik an der Universität Stuttgart-Hohenheim und Professor Dr. Uwe Jensen R. Oldenbourg
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler
 Knut Sydsaeter Peter HammondJ Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler Basiswissen mit Praxisbezug 2., aktualisierte Auflage Inhaltsverzeichnis Vorwort 13 Vorwort zur zweiten Auflage 19 Kapitel 1 Einführung,
Knut Sydsaeter Peter HammondJ Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler Basiswissen mit Praxisbezug 2., aktualisierte Auflage Inhaltsverzeichnis Vorwort 13 Vorwort zur zweiten Auflage 19 Kapitel 1 Einführung,
Analysis für Wirtschaftswissenschaftler und Ingenieure
 Dieter Hoffmann 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Analysis für Wirtschaftswissenschaftler und Ingenieure
Dieter Hoffmann 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Analysis für Wirtschaftswissenschaftler und Ingenieure
Inhalt. 1 Atombau Die chemische Bindung Energetik chemischer Reaktionen 50. Vorwort 9
 Vorwort 9 1 Atombau 10 1.1 Dalton-Modell 10 1.2 Thomson-Modell 12 1.3 Kern-Hülle-Modell (Rutherford-Modell) 12 1.4 Bohrsches Atommodell 14 1.5 Schalenmodell Bau der Atomhülle 18 1.6 Orbitalmodell 20 Kennzeichen
Vorwort 9 1 Atombau 10 1.1 Dalton-Modell 10 1.2 Thomson-Modell 12 1.3 Kern-Hülle-Modell (Rutherford-Modell) 12 1.4 Bohrsches Atommodell 14 1.5 Schalenmodell Bau der Atomhülle 18 1.6 Orbitalmodell 20 Kennzeichen
Inhaltsverzeichnis. 1 Lineare Algebra 12
 Inhaltsverzeichnis 1 Lineare Algebra 12 1.1 Vektorrechnung 12 1.1.1 Grundlagen 12 1.1.2 Lineare Abhängigkeit 18 1.1.3 Vektorräume 22 1.1.4 Dimension und Basis 24 1.2 Matrizen 26 1.2.1 Definition einer
Inhaltsverzeichnis 1 Lineare Algebra 12 1.1 Vektorrechnung 12 1.1.1 Grundlagen 12 1.1.2 Lineare Abhängigkeit 18 1.1.3 Vektorräume 22 1.1.4 Dimension und Basis 24 1.2 Matrizen 26 1.2.1 Definition einer
W. Oevel. Mathematik II für Informatiker. Veranstaltungsnr: Skript zur Vorlesung, Universität Paderborn, Sommersemester 2002
 W. Oevel Mathematik II für Informatiker Veranstaltungsnr: 172010 Skript zur Vorlesung, Universität Paderborn, Sommersemester 2002 Inhalt 1 Komplexe Zahlen 1 1.1 Definitionen..............................
W. Oevel Mathematik II für Informatiker Veranstaltungsnr: 172010 Skript zur Vorlesung, Universität Paderborn, Sommersemester 2002 Inhalt 1 Komplexe Zahlen 1 1.1 Definitionen..............................
Brückenkurs Mathematik
 Brückenkurs Mathematik Von Dr. Karl Bosch Professor für angewandte Mathematik und Statistik an der Universität Stuttgart-Hohenheim 10., verbesserte Auflage R. Oldenbourg Verlag München Wien Inhaltsverzeichnis
Brückenkurs Mathematik Von Dr. Karl Bosch Professor für angewandte Mathematik und Statistik an der Universität Stuttgart-Hohenheim 10., verbesserte Auflage R. Oldenbourg Verlag München Wien Inhaltsverzeichnis
Stichpunkte zum Abschnitt Analysis der Höheren Mathematik für Ingenieure I
 Stichpunkte zum Abschnitt Analysis der Höheren Mathematik für Ingenieure I Komplexe Zahlen Definition komplexer Zahlen in der Gaußschen Zahlenebene, algebraische Form, trigonometrische Form, exponentielle
Stichpunkte zum Abschnitt Analysis der Höheren Mathematik für Ingenieure I Komplexe Zahlen Definition komplexer Zahlen in der Gaußschen Zahlenebene, algebraische Form, trigonometrische Form, exponentielle
Synopse. - zuletzt geändert durch den 13. Änderungsbeschluss vom Chemie L3
 Synopse Vierzehnter Beschluss des ZfL vom 13.02.2013 zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den Studiengang Lehramt an Gymnasien vom 23.08.2006 - zuletzt geändert durch den 13. Änderungsbeschluss
Synopse Vierzehnter Beschluss des ZfL vom 13.02.2013 zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den Studiengang Lehramt an Gymnasien vom 23.08.2006 - zuletzt geändert durch den 13. Änderungsbeschluss
MODULHANDBUCH. Studiengang Bachelor Chemieingenieurwesen (B.Sc.) Fachbereich Chemieingenieurwesen. WS 2009_2010 (Dez.. 2009)
 MODULHANDBUCH Studiengang Fachbereich Chemieingenieurwesen WS 2009_2010 (Dez.. 2009) Fachbereich 01-Chemieingenieurwesen Stegerwaldstraße 39 48565 Steinfurt Tel.: 02551-962193 Fax.: 02551-962711 e-mail:
MODULHANDBUCH Studiengang Fachbereich Chemieingenieurwesen WS 2009_2010 (Dez.. 2009) Fachbereich 01-Chemieingenieurwesen Stegerwaldstraße 39 48565 Steinfurt Tel.: 02551-962193 Fax.: 02551-962711 e-mail:
Inhalt. 1 Rechenoperationen Gleichungen und Ungleichungen... 86
 Inhalt 1 Rechenoperationen.................................. 13 1.1 Grundbegriffe der Mengenlehre und Logik............................. 13 1.1.0 Vorbemerkung.................................................
Inhalt 1 Rechenoperationen.................................. 13 1.1 Grundbegriffe der Mengenlehre und Logik............................. 13 1.1.0 Vorbemerkung.................................................
1.Semester Bachelor Chemie
 1.Semester Bachelor Chemie 1 Modul: 08-AC1 Anorganische Chemie 1 23 S Studentischer Arbeitsaufwand: 600 h 20 ECTS Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen Chemie 1.1 Teilmodul: 08-AC1-1 Grundlagen
1.Semester Bachelor Chemie 1 Modul: 08-AC1 Anorganische Chemie 1 23 S Studentischer Arbeitsaufwand: 600 h 20 ECTS Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen Chemie 1.1 Teilmodul: 08-AC1-1 Grundlagen
Roland Reich. Thermodynamik. Grundlagen und Anwendungen in der allgemeinen Chemie. Zweite, verbesserte Auflage VCH. Weinheim New York Basel Cambridge
 Roland Reich Thermodynamik Grundlagen und Anwendungen in der allgemeinen Chemie Zweite, verbesserte Auflage VCH Weinheim New York Basel Cambridge Inhaltsverzeichnis Formelzeichen Maßeinheiten XV XX 1.
Roland Reich Thermodynamik Grundlagen und Anwendungen in der allgemeinen Chemie Zweite, verbesserte Auflage VCH Weinheim New York Basel Cambridge Inhaltsverzeichnis Formelzeichen Maßeinheiten XV XX 1.
Modulbeschreibung: Bachelor of Education Chemie
 Modulbeschreibung: Bachelor of Education Chemie Modul 1: Allgemeine und anorganische Chemie 1 - Grundlagen 1 300 h 10 LP 1. Sem 1 Semester a) Vorlesung: Vorlesung Anorganische und Allgemeine Chemie (P)
Modulbeschreibung: Bachelor of Education Chemie Modul 1: Allgemeine und anorganische Chemie 1 - Grundlagen 1 300 h 10 LP 1. Sem 1 Semester a) Vorlesung: Vorlesung Anorganische und Allgemeine Chemie (P)
1 ALLGEMEINE HINWEISE Das Fach Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler Bisheriger Aufbau der Klausur...
 Grundlagen Mathe V Inhaltsverzeichnis 1 ALLGEMEINE HINWEISE... 1-1 1.1 Das Fach Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler... 1-1 1.2 Bisheriger Aufbau der Klausur... 1-1 1.3 Zugelassene Hilfsmittel und
Grundlagen Mathe V Inhaltsverzeichnis 1 ALLGEMEINE HINWEISE... 1-1 1.1 Das Fach Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler... 1-1 1.2 Bisheriger Aufbau der Klausur... 1-1 1.3 Zugelassene Hilfsmittel und
Modulhandbuch der beruflichen Fachrichtung
 Modulhandbuch der beruflichen Fachrichtung Chemietechnik für die Studiengänge Berufliche und allgemeine Bildung (BAB) und Berufliche Bildung (BB) Fachwissenschaftliche Module der beruflichen Fachrichtung
Modulhandbuch der beruflichen Fachrichtung Chemietechnik für die Studiengänge Berufliche und allgemeine Bildung (BAB) und Berufliche Bildung (BB) Fachwissenschaftliche Module der beruflichen Fachrichtung
Fach Mathematik. Stundentafel. Bildungsziel
 Fach Mathematik Stundentafel Jahr 1. 2. 3. 4. Grundlagen 4 4 4 5 Bildungsziel Der Mathematikunterricht schult das exakte Denken, das folgerichtige Schliessen und Deduzieren, einen präzisen Sprachgebrauch
Fach Mathematik Stundentafel Jahr 1. 2. 3. 4. Grundlagen 4 4 4 5 Bildungsziel Der Mathematikunterricht schult das exakte Denken, das folgerichtige Schliessen und Deduzieren, einen präzisen Sprachgebrauch
Modulhandbuch. der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät. der Universität zu Köln. für den Lernbereich Mathematische Grundbildung
 Modulhandbuch der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln für den Lernbereich Mathematische Grundbildung im Studiengang Bachelor of Arts mit bildungswissenschaftlichem Anteil
Modulhandbuch der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln für den Lernbereich Mathematische Grundbildung im Studiengang Bachelor of Arts mit bildungswissenschaftlichem Anteil
a) Welche der folgenden Aussagen treffen nicht zu? (Dies bezieht sind nur auf Aufgabenteil a)
 Aufgabe 1: Multiple Choice (10P) Geben Sie an, welche der Aussagen richtig sind. Unabhängig von der Form der Fragestellung (Singular oder Plural) können eine oder mehrere Antworten richtig sein. a) Welche
Aufgabe 1: Multiple Choice (10P) Geben Sie an, welche der Aussagen richtig sind. Unabhängig von der Form der Fragestellung (Singular oder Plural) können eine oder mehrere Antworten richtig sein. a) Welche
Lehramtstudium Physik für Gymnasien. Modulhandbuch Sommersemester 2009
 Lehramtstudium Physik für Gymnasien Modulhandbuch Sommersemester 2009 Unvollständiger Entwurf, 25.01.2009 Fachsemester 2 SS 2009 Experimentalphysik 2 1 EPL-2 (Lehramt für Gymnasien) 2 Lehrveranstaltungen
Lehramtstudium Physik für Gymnasien Modulhandbuch Sommersemester 2009 Unvollständiger Entwurf, 25.01.2009 Fachsemester 2 SS 2009 Experimentalphysik 2 1 EPL-2 (Lehramt für Gymnasien) 2 Lehrveranstaltungen
Passerelle. Beschrieb der Fach-Module. von der Berufsmaturität. zu den universitären Hochschulen
 Passerelle von der Berufsmaturität zu den universitären Hochschulen Beschrieb der Fach-Module Fachbereich Mathematik Teilmodule Teilmodul 1: Analysis (Differential- und Integralrechnung) Teilmodul 2: Vektorgeometrie
Passerelle von der Berufsmaturität zu den universitären Hochschulen Beschrieb der Fach-Module Fachbereich Mathematik Teilmodule Teilmodul 1: Analysis (Differential- und Integralrechnung) Teilmodul 2: Vektorgeometrie
CH-Matura TB 1 THEMENBEREICH 1: Themenbereiche Chemie. AGMueller2014V3
 TB 1 THEMENBEREICH 1: STOFFEIGENSCHAFTEN, ATOMBAU Der Kandidat/ die Kandidatin kennt die wichtigsten Stoffeigenschaften und einfache Methoden um diese zu bestimmen. Er/Sie kann den Atombau nach BOHR erklären
TB 1 THEMENBEREICH 1: STOFFEIGENSCHAFTEN, ATOMBAU Der Kandidat/ die Kandidatin kennt die wichtigsten Stoffeigenschaften und einfache Methoden um diese zu bestimmen. Er/Sie kann den Atombau nach BOHR erklären
Technische Universität Ilmenau
 Technische Universität Ilmenau Prüfungsordnung Besondere Bestimmungen für den Studiengang Technische Physik mit dem Abschluss Bachelor of Science Gemäß 5 Abs. 1 in Verbindung mit 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 11,
Technische Universität Ilmenau Prüfungsordnung Besondere Bestimmungen für den Studiengang Technische Physik mit dem Abschluss Bachelor of Science Gemäß 5 Abs. 1 in Verbindung mit 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 11,
Brückenkurs Mathematik
 Informationen zur Lehrveranstaltung andreas.kucher@uni-graz.at Institute for Mathematics and Scientific Computing Karl-Franzens-Universität Graz Graz, July 19, 2016 Übersicht Motivation Motivation für
Informationen zur Lehrveranstaltung andreas.kucher@uni-graz.at Institute for Mathematics and Scientific Computing Karl-Franzens-Universität Graz Graz, July 19, 2016 Übersicht Motivation Motivation für
Mathematik. Modul-Nr./ Code 6.1. ECTS-Credits 5. Gewichtung der Note in der Gesamtnote 5 / 165
 Mathematik Modul-Nr./ Code 6.1 ECTS-Credits 5 Gewichtung der Note in der Gesamtnote 5 / 165 Modulverantwortliche Semester Qualifikationsziele des Moduls Prof. Dr. B. Christensen, Prof. Dr. B. Kuhnigk,
Mathematik Modul-Nr./ Code 6.1 ECTS-Credits 5 Gewichtung der Note in der Gesamtnote 5 / 165 Modulverantwortliche Semester Qualifikationsziele des Moduls Prof. Dr. B. Christensen, Prof. Dr. B. Kuhnigk,
Chemielaborant 1. Ausbildungsjahr 1,5 Tage Unterricht pro Woche
 BS2 Augsburg FG Chemie Chemielaborant 1. Ausbildungsjahr 1,5 Tage Unterricht pro Woche Allgemeiner Allgemeiner Unterricht Unterricht 1 Stunde Deutsch 1 Stunde Religion 1 Stunde Religion 1 Stunde Sozialkunde
BS2 Augsburg FG Chemie Chemielaborant 1. Ausbildungsjahr 1,5 Tage Unterricht pro Woche Allgemeiner Allgemeiner Unterricht Unterricht 1 Stunde Deutsch 1 Stunde Religion 1 Stunde Religion 1 Stunde Sozialkunde
Lehramt an Haupt- und Realschulen L2 und Förderschulen L5. Mathematik
 Lehramt an Haupt- und Realschulen L2 und Förderschulen L5 Mathematik Mathematik L2 / L5 Modul 1 bis 3: Mathematik Fachwissenschaft Modul 4 bis 6: Didaktik der Mathematik Schulpraktikum Modul 1 bis 3 Wissenschaftliche
Lehramt an Haupt- und Realschulen L2 und Förderschulen L5 Mathematik Mathematik L2 / L5 Modul 1 bis 3: Mathematik Fachwissenschaft Modul 4 bis 6: Didaktik der Mathematik Schulpraktikum Modul 1 bis 3 Wissenschaftliche
Credits. Studiensemester. 1. Sem. Kontaktzeit 4 SWS / 60 h 2 SWS / 30 h
 Modulhandbuch für den Lernbereich Mathematische Grundbildung im Studiengang Bachelor of Arts mit bildungswissenschaftlichem Anteil für die Studienprofile Lehramt an Grundschulen und Lehramt für sonderpädagogische
Modulhandbuch für den Lernbereich Mathematische Grundbildung im Studiengang Bachelor of Arts mit bildungswissenschaftlichem Anteil für die Studienprofile Lehramt an Grundschulen und Lehramt für sonderpädagogische
Allgemeine und Analytische Chemie Anorganische und Analytische Chemie Untertitel AAC/Pflichtmodul 20 ECTS CP
 Modulbeschreibungen für Chemie als Nebenfach (Umfang 18 Punkte) Nach vorheriger Absprache mit den der Chemie ist in besonderen Fällen der Ersatz von aktika und Vorlesungen aus dem Modul durch anderer Veranstaltungen
Modulbeschreibungen für Chemie als Nebenfach (Umfang 18 Punkte) Nach vorheriger Absprache mit den der Chemie ist in besonderen Fällen der Ersatz von aktika und Vorlesungen aus dem Modul durch anderer Veranstaltungen
Physikalische Chemie. Heinz Hug Wolfgang Reiser EHRMITTEL. EUROPA-FACHBUCHREIHE für Chemieberufe. 2. neu bearbeitete Auflage. von
 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. EHRMITTEL EUROPA-FACHBUCHREIHE für Chemieberufe Physikalische Chemie
2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. EHRMITTEL EUROPA-FACHBUCHREIHE für Chemieberufe Physikalische Chemie
STUDIENPLAN FÜR DEN DIPLOM-STUDIENGANG TECHNOMATHEMATIK an der Technischen Universität München. Übersicht Vorstudium
 STUDIENPLAN FÜR DEN DIPLOM-STUDIENGANG TECHNOMATHEMATIK an der Technischen Universität München Übersicht Vorstudium Das erste Anwendungsgebiet im Grundstudium ist Physik (1. und 2. Sem.) Im 3. und 4. Sem.
STUDIENPLAN FÜR DEN DIPLOM-STUDIENGANG TECHNOMATHEMATIK an der Technischen Universität München Übersicht Vorstudium Das erste Anwendungsgebiet im Grundstudium ist Physik (1. und 2. Sem.) Im 3. und 4. Sem.
Mathematik für Physiker 1
 Klaus Weltner Mathematik für Physiker 1 Basiswissen für das Grundstudium der Experimentalphysik 14. überarbeitete Auflage mit 231 Abbildungen und CD-ROM verfasst von Klaus Weltner, Hartmut Wiesner, Paul-Bernd
Klaus Weltner Mathematik für Physiker 1 Basiswissen für das Grundstudium der Experimentalphysik 14. überarbeitete Auflage mit 231 Abbildungen und CD-ROM verfasst von Klaus Weltner, Hartmut Wiesner, Paul-Bernd
Inhaltsverzeichnis. I A n alysis Grundlagen über Mengen und die Sätze von Bolzano-Weierstrass 55
 Inhaltsverzeichnis I A n alysis 1 9 1 G rundlagen 11 1.1 Motivation... 11 1.2 G rundlagen... 12 1.2.1 Funktionen... 12 1.2.2 Eigenschaften von Funktionen... 13 1.2.3 Verkettete Funktionen... 15 1.2.4 Reelle
Inhaltsverzeichnis I A n alysis 1 9 1 G rundlagen 11 1.1 Motivation... 11 1.2 G rundlagen... 12 1.2.1 Funktionen... 12 1.2.2 Eigenschaften von Funktionen... 13 1.2.3 Verkettete Funktionen... 15 1.2.4 Reelle
LEHRPLAN MATHEMATIK SPORT- UND MUSIKKLASSE
 LEHRPLAN MATHEMATIK SPORT- UND MUSIKKLASSE STUNDENDOTATION GF EF 3. KLASSE 1. SEM. 4 2. SEM. 4 4. KLASSE 1. SEM. 3 2. SEM. 3 5. KLASSE 1. SEM. 3 2. SEM. 3 6. KLASSE 1. SEM. 3 2 2. SEM. 3 2 7. KLASSE 1.
LEHRPLAN MATHEMATIK SPORT- UND MUSIKKLASSE STUNDENDOTATION GF EF 3. KLASSE 1. SEM. 4 2. SEM. 4 4. KLASSE 1. SEM. 3 2. SEM. 3 5. KLASSE 1. SEM. 3 2. SEM. 3 6. KLASSE 1. SEM. 3 2 2. SEM. 3 2 7. KLASSE 1.
B-P 11: Mathematik für Physiker
 B-P 11: Mathematik für Physiker Status: freigegeben Modulziele Erwerb der Grundkenntnisse der Analysis, der Linearen Algebra und Rechenmethoden der Physik Modulelemente Mathematik für Physiker I: Analysis
B-P 11: Mathematik für Physiker Status: freigegeben Modulziele Erwerb der Grundkenntnisse der Analysis, der Linearen Algebra und Rechenmethoden der Physik Modulelemente Mathematik für Physiker I: Analysis
Modulhandbuch für das. Wahlfach Umweltchemie im Zweifach-Bachelor- Studiengang
 Modulhandbuch für das Wahlfach Umweltchemie im Zweifach-Bachelor- Studiengang Fachbereich 7, Campus Landau Autoren: Prof. Dr. Gabriele E. Schaumann, Prof. Dr. Björn Risch, Dr. Bertram Schmidkonz Stand
Modulhandbuch für das Wahlfach Umweltchemie im Zweifach-Bachelor- Studiengang Fachbereich 7, Campus Landau Autoren: Prof. Dr. Gabriele E. Schaumann, Prof. Dr. Björn Risch, Dr. Bertram Schmidkonz Stand
Bemerkung: Termine und Orte für die einzelnen Lehrveranstaltungen sind dem Stundenplan zu entnehmen.
 Allgemeine Modulbeschreibungen für das erste Semester Bachelor Informatik 1. Objektorientierte Programmierung Bestehend aus - Vorlesung Objektorientierte Programmierung (Prof. Zimmermann) - Übung zu obiger
Allgemeine Modulbeschreibungen für das erste Semester Bachelor Informatik 1. Objektorientierte Programmierung Bestehend aus - Vorlesung Objektorientierte Programmierung (Prof. Zimmermann) - Übung zu obiger
Mathematik im Betrieb
 Heinrich Holland/Doris Holland Mathematik im Betrieb Praxisbezogene Einführung mit Beispielen 7, überarbeitete Auflage GABLER Inhaltsverzeichnis Vorwort 1 Mathematische Grundlagen 1.1 Zahlbegriffe 1.2
Heinrich Holland/Doris Holland Mathematik im Betrieb Praxisbezogene Einführung mit Beispielen 7, überarbeitete Auflage GABLER Inhaltsverzeichnis Vorwort 1 Mathematische Grundlagen 1.1 Zahlbegriffe 1.2
Modulkatalog: Kernbereich des Schwerpunktfachs Physik
 Die Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät 7 der Universität des Saarlandes Fachrichtung Physik Modulkatalog: Kernbereich des Schwerpunktfachs Physik Fassung vom 12. August 2015 auf Grundlage der Prüfungs-
Die Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät 7 der Universität des Saarlandes Fachrichtung Physik Modulkatalog: Kernbereich des Schwerpunktfachs Physik Fassung vom 12. August 2015 auf Grundlage der Prüfungs-
Formelsammlung für Wirtschaftswissenschaftler
 Fred Böker Formelsammlung für Wirtschaftswissenschaftler Mathematik und Statistik PEARSON.. ;. ; ; ; *:;- V f - - ' / > Щ DtUClllirn ein Imprint von Pearson Education München Boston San Francisco Harlow,
Fred Böker Formelsammlung für Wirtschaftswissenschaftler Mathematik und Statistik PEARSON.. ;. ; ; ; *:;- V f - - ' / > Щ DtUClllirn ein Imprint von Pearson Education München Boston San Francisco Harlow,
Themenpool teilzentrale Reifeprüfung Mathematik Europagymnasium Auhof, Aubrunnerweg 4, 4040 Linz; Schulkennzahl:
 Themenpool teilzentrale Reifeprüfung Mathematik Europagymnasium Auhof, Aubrunnerweg 4, 4040 Linz; Schulkennzahl: 401546 Thema 1: Zahlenbereiche und Rechengesetze Reflektieren über das Erweitern von Zahlenbereichen
Themenpool teilzentrale Reifeprüfung Mathematik Europagymnasium Auhof, Aubrunnerweg 4, 4040 Linz; Schulkennzahl: 401546 Thema 1: Zahlenbereiche und Rechengesetze Reflektieren über das Erweitern von Zahlenbereichen
Vorprüfung in Chemie für Studierende des Maschinenbaus und des Gewerbelehramts Studiengang Bachelor
 Grundlagen der Chemie für Studierende des Maschinenbaus, Prof. Deutschmann Vorprüfung in Chemie für Studierende des Maschinenbaus und des Gewerbelehramts Studiengang Bachelor Freitag, 20. März 2009, 14:00-17:00
Grundlagen der Chemie für Studierende des Maschinenbaus, Prof. Deutschmann Vorprüfung in Chemie für Studierende des Maschinenbaus und des Gewerbelehramts Studiengang Bachelor Freitag, 20. März 2009, 14:00-17:00
Kantonsschule Ausserschwyz. Mathematik. Kantonsschule Ausserschwyz 83
 Kantonsschule Ausserschwyz Mathematik Kantonsschule Ausserschwyz 83 Bildungsziele Für das Grundlagenfach Die Schülerinnen und Schüler sollen über ein grundlegendes Orientierungs- und Strukturwissen in
Kantonsschule Ausserschwyz Mathematik Kantonsschule Ausserschwyz 83 Bildungsziele Für das Grundlagenfach Die Schülerinnen und Schüler sollen über ein grundlegendes Orientierungs- und Strukturwissen in
S.L. Salas/Einar Hille. Calculus. Einführung in die Differential- und Integralrechnung
 * S.L. Salas/Einar Hille Calculus Einführung in die Differential- und Integralrechnung Aus dem Amerikanischen von Michael Basler, Thomas Lange und Karl-Heinz Lotze Mit 670 Abbildungen Spektrum Akademischer
* S.L. Salas/Einar Hille Calculus Einführung in die Differential- und Integralrechnung Aus dem Amerikanischen von Michael Basler, Thomas Lange und Karl-Heinz Lotze Mit 670 Abbildungen Spektrum Akademischer
Vorlesung Organische Chemie II Reaktionsmechanismen (3. Sem.)
 Vorlesung Organische Chemie II Reaktionsmechanismen (3. Sem.) Gliederung Grundlagen der physikalisch-organischen Chemie Radikalreaktionen Nukleophile und elektrophile Substitution am gesättigten C-Atom
Vorlesung Organische Chemie II Reaktionsmechanismen (3. Sem.) Gliederung Grundlagen der physikalisch-organischen Chemie Radikalreaktionen Nukleophile und elektrophile Substitution am gesättigten C-Atom
SS 2016 Höhere Mathematik für s Studium der Physik 21. Juli Probeklausur. Die Antworten zu den jeweiligen Fragen sind in blauer Farbe notiert.
 SS 6 Höhere Mathematik für s Studium der Physik. Juli 6 Probeklausur Die Antworten zu den jeweiligen Fragen sind in blauer Farbe notiert. Fragen Sei (X, d) ein metrischer Raum. Beantworten Sie die nachfolgenden
SS 6 Höhere Mathematik für s Studium der Physik. Juli 6 Probeklausur Die Antworten zu den jeweiligen Fragen sind in blauer Farbe notiert. Fragen Sei (X, d) ein metrischer Raum. Beantworten Sie die nachfolgenden
Praktika Physikalische Chemie Wintersemester 2016 / 2017 Informationen PCAP
 Dr. Ludwig Kibler 01.09.2016 PCAP Infos Praktika Physikalische Chemie Wintersemester 2016 / 2017 Informationen PCAP Seite 2 Ansprechpartner Organisation und Dozenten Studienkommission Chemie (Prof. Thorsten
Dr. Ludwig Kibler 01.09.2016 PCAP Infos Praktika Physikalische Chemie Wintersemester 2016 / 2017 Informationen PCAP Seite 2 Ansprechpartner Organisation und Dozenten Studienkommission Chemie (Prof. Thorsten
MATHEMATISCHE AUFGABENSAMMLUNG
 MATHEMATISCHE AUFGABENSAMMLUNG Arithmetik Algebra und Analysis Zweite verbesserte Auflage 1956 VEB DEUTSCHER VERLAG DER WISSENSCHAFTEN BERLIN VII INHALT ERSTER ABSCHNITT Rechnen mit natürlichen Zahlen
MATHEMATISCHE AUFGABENSAMMLUNG Arithmetik Algebra und Analysis Zweite verbesserte Auflage 1956 VEB DEUTSCHER VERLAG DER WISSENSCHAFTEN BERLIN VII INHALT ERSTER ABSCHNITT Rechnen mit natürlichen Zahlen
Chemie
 01.04.2014 mie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Übersicht mie (Hauptfach) Modul 1... 54 Modul 2... 56 Modul 3...
01.04.2014 mie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Übersicht mie (Hauptfach) Modul 1... 54 Modul 2... 56 Modul 3...
Karl Stephan Franz Mayinger. Thermodynamik. Grundlagen und technische Anwendungen. Zwölfte, neubearbeitete und erweiterte Auflage
 Karl Stephan Franz Mayinger Thermodynamik Grundlagen und technische Anwendungen Zwölfte, neubearbeitete und erweiterte Auflage Band 2 Mehrstoffsysteme und chemische Reaktionen Mit 135 Abbildungen Springer-Verlag
Karl Stephan Franz Mayinger Thermodynamik Grundlagen und technische Anwendungen Zwölfte, neubearbeitete und erweiterte Auflage Band 2 Mehrstoffsysteme und chemische Reaktionen Mit 135 Abbildungen Springer-Verlag
April (Voll-) Klausur Analysis I für Ingenieure. Rechenteil
 April (Voll-) Klausur Analysis I für Ingenieure en Rechenteil Aufgabe 7 Punkte (a) Skizzieren Sie die 4-periodische Funktion mit f() = für und f() = für (b) Berechnen Sie für diese Funktion die Fourierkoeffizienten
April (Voll-) Klausur Analysis I für Ingenieure en Rechenteil Aufgabe 7 Punkte (a) Skizzieren Sie die 4-periodische Funktion mit f() = für und f() = für (b) Berechnen Sie für diese Funktion die Fourierkoeffizienten
MATHEMATIK. 1 Stundendotation. 2 Didaktische Hinweise. 4. Klasse. 1. Klasse. 3. Klasse. 5. Klasse. 2. Klasse
 MATHEMATIK 1 Stundendotation 1. 2. 3. 4. 5. 6. Arithmetik und Algebra 4 3 Geometrie 2 3 Grundlagenfach 4 4 4 4 Schwerpunktfach Ergänzungsfach Weiteres Fach 2 Didaktische Hinweise Der Unterricht im Grundlagenfach
MATHEMATIK 1 Stundendotation 1. 2. 3. 4. 5. 6. Arithmetik und Algebra 4 3 Geometrie 2 3 Grundlagenfach 4 4 4 4 Schwerpunktfach Ergänzungsfach Weiteres Fach 2 Didaktische Hinweise Der Unterricht im Grundlagenfach
Bekannter Stoff aus dem 1. Semester:
 Bekannter Stoff aus dem 1. Semester: Atombau! Arten der Teilchen! Elemente/Isotope! Kernchemie! Elektronenhülle/Quantenzahlen Chemische Bindung! Zustände der Materie! Ionenbindung! Atombindung! Metallbindung
Bekannter Stoff aus dem 1. Semester: Atombau! Arten der Teilchen! Elemente/Isotope! Kernchemie! Elektronenhülle/Quantenzahlen Chemische Bindung! Zustände der Materie! Ionenbindung! Atombindung! Metallbindung
Das wissen Sie: 6. Welche Möglichkeiten zur Darstellung periodischer Funktionen (Signalen) kennen Sie?
 Das wissen Sie: 1. Wann ist eine Funktion (Signal) gerade, ungerade, harmonisch, periodisch (Kombinationsbeispiele)? 2. Wie lassen sich harmonische Schwingungen mathematisch beschreiben und welche Beziehungen
Das wissen Sie: 1. Wann ist eine Funktion (Signal) gerade, ungerade, harmonisch, periodisch (Kombinationsbeispiele)? 2. Wie lassen sich harmonische Schwingungen mathematisch beschreiben und welche Beziehungen
Mathematik in der Biologie
 Erich Bohl Mathematik in der Biologie 4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage Mit 65 Abbildungen und 16 Tabellen ^J Springer Inhaltsverzeichnis Warum verwendet ein Biologe eigentlich Mathematik?
Erich Bohl Mathematik in der Biologie 4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage Mit 65 Abbildungen und 16 Tabellen ^J Springer Inhaltsverzeichnis Warum verwendet ein Biologe eigentlich Mathematik?
Angewandte Mathematik und Programmierung
 Angewandte Mathematik und Programmierung Einführung in das Konzept der objektorientierten Anwendungen zu wissenschaftlichen Rechnens mit C++ und Matlab SS2013 Inhalt Bis jetzt : Die grundlegende Aspekte
Angewandte Mathematik und Programmierung Einführung in das Konzept der objektorientierten Anwendungen zu wissenschaftlichen Rechnens mit C++ und Matlab SS2013 Inhalt Bis jetzt : Die grundlegende Aspekte
MATHEMATIK. 1 Stundendotation. 2 Didaktische Hinweise G1 G2 G3 G4 G5 G6
 MATHEMATIK 1 Stundendotation G1 G2 G3 G4 G5 G6 Arithmetik und Algebra 4 3 Geometrie 2 3 Grundlagenfach 4 4 4 4 Schwerpunktfach Ergänzungsfach Weiteres Pflichtfach Weiteres Fach 2 Didaktische Hinweise Der
MATHEMATIK 1 Stundendotation G1 G2 G3 G4 G5 G6 Arithmetik und Algebra 4 3 Geometrie 2 3 Grundlagenfach 4 4 4 4 Schwerpunktfach Ergänzungsfach Weiteres Pflichtfach Weiteres Fach 2 Didaktische Hinweise Der
Reaktionsmechanismen
 Reaktionsmechanismen Prof. Peter Bäuerle Copyright: Prof. Peter Bäuerle, 1 VL OC I: Grundlagen strukturiert nach Stoffklassen (physikalische und chemische Eigenschaften von organischen Verbindungen) VL
Reaktionsmechanismen Prof. Peter Bäuerle Copyright: Prof. Peter Bäuerle, 1 VL OC I: Grundlagen strukturiert nach Stoffklassen (physikalische und chemische Eigenschaften von organischen Verbindungen) VL
Aufgabensammlung mit Lösungen zur Mathematik für Nichtmathematiker
 Aufgabensammlung mit Lösungen zur Mathematik für Nichtmathematiker Grundbegriffe - Funktionen einer und mehrerer Veränderlicher - Folgen und Reihen, Zinsrechnung - Differential- und Integralrechnung-Vektorrechnung
Aufgabensammlung mit Lösungen zur Mathematik für Nichtmathematiker Grundbegriffe - Funktionen einer und mehrerer Veränderlicher - Folgen und Reihen, Zinsrechnung - Differential- und Integralrechnung-Vektorrechnung
Analysis. mit dem Computer-Algebra-System des TI-92. Anhang 2: Gedanken zum Lehrplan. Beat Eicke und Edmund Holzherr 11.
 ETH EIDGENÖSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZÜRICH Analysis mit dem Computer-Algebra-System des TI-92 Anhang 2: Gedanken zum Lehrplan Beat Eicke und Edmund Holzherr 11. November 1997 Eidgenössische Technische
ETH EIDGENÖSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZÜRICH Analysis mit dem Computer-Algebra-System des TI-92 Anhang 2: Gedanken zum Lehrplan Beat Eicke und Edmund Holzherr 11. November 1997 Eidgenössische Technische
Modul: Spectroscopy with synchrotron radiation/spektroskopie mit Synchrotronstrahlung
 Modul: Spectroscopy with synchrotron radiation/spektroskopie mit Synchrotronstrahlung Qualifikationsziele: Das Modul dient der individuellen Schwerpunktsetzung der Studierenden. Die Studierenden haben
Modul: Spectroscopy with synchrotron radiation/spektroskopie mit Synchrotronstrahlung Qualifikationsziele: Das Modul dient der individuellen Schwerpunktsetzung der Studierenden. Die Studierenden haben
ABTEILUNG CHEMIE Laboranten Lehrjahr ANORGANISCHE CHEMIE St. Magyar/ A. Soi S t o f f p l a n Laborant/in Fachrichtung Chemie
 Beruf: Fach: Laborant/in Fachrichtung Chemie Allgemeine und Anorganische Chemie S t o f f p l a n Bildungsverordnung vom: Semester: 1-6 Lektionen: 210 Lehrmittel: Elemente ISBN 978-3-264-83645-5 1.8.2008
Beruf: Fach: Laborant/in Fachrichtung Chemie Allgemeine und Anorganische Chemie S t o f f p l a n Bildungsverordnung vom: Semester: 1-6 Lektionen: 210 Lehrmittel: Elemente ISBN 978-3-264-83645-5 1.8.2008
3 Folgen, Reihen, Grenzwerte 3.1 Zahlenfolgen Definition: Eine Folge ist eine geordnete Menge von Elementen an (den sogenannten Gliedern ), die
 3 Folgen, Reihen, Grenzwerte 3.1 Zahlenfolgen Definition: Eine Folge ist eine geordnete Menge von Elementen an (den sogenannten Gliedern ), die eindeutig den natürlichen Zahlen zugeordnet sind ( n N, auch
3 Folgen, Reihen, Grenzwerte 3.1 Zahlenfolgen Definition: Eine Folge ist eine geordnete Menge von Elementen an (den sogenannten Gliedern ), die eindeutig den natürlichen Zahlen zugeordnet sind ( n N, auch
Prof. Dr. Hans-Christoph Mertins
 Physik I+II Prof. Dr. Hans-Christoph Mertins Umfang Biomedizintechnik 2 Semester Modul Physik I+II Lasertechnik 3 Semester Module Physik I+II und Physik III Vorlesung 4h / Wo Übung 1h / Wo, evtl. in halber
Physik I+II Prof. Dr. Hans-Christoph Mertins Umfang Biomedizintechnik 2 Semester Modul Physik I+II Lasertechnik 3 Semester Module Physik I+II und Physik III Vorlesung 4h / Wo Übung 1h / Wo, evtl. in halber
Höhere Mathematik für Physiker II
 Universität Heidelberg Sommersemester 2013 Wiederholungsblatt Übungen zur Vorlesung Höhere Mathematik für Physiker II Prof Dr Anna Marciniak-Czochra Dipl Math Alexandra Köthe Fragen Machen Sie sich bei
Universität Heidelberg Sommersemester 2013 Wiederholungsblatt Übungen zur Vorlesung Höhere Mathematik für Physiker II Prof Dr Anna Marciniak-Czochra Dipl Math Alexandra Köthe Fragen Machen Sie sich bei
Anlage 1 für Cluster 1b (allgemeine technische Mathematik) ANGEWANDTE MATHEMATIK
 1 von 5 Anlage 1 für Cluster 1b (allgemeine technische Mathematik) ANGEWANDTE MATHEMATIK I. J a h r g a n g : - kennen den Mengenbegriff und können die grundlegenden Mengenoperationen zur Darstellung von
1 von 5 Anlage 1 für Cluster 1b (allgemeine technische Mathematik) ANGEWANDTE MATHEMATIK I. J a h r g a n g : - kennen den Mengenbegriff und können die grundlegenden Mengenoperationen zur Darstellung von
Chemieingenieurwesen
 Fakultät Maschinenbau/ Verfahrenstechnik Studienordnung für den Bachelorstudiengang Chemieingenieurwesen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden University of Applied Sciences Vom 11. Juni
Fakultät Maschinenbau/ Verfahrenstechnik Studienordnung für den Bachelorstudiengang Chemieingenieurwesen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden University of Applied Sciences Vom 11. Juni
Modulhandbuch Bachelorstudiengang Physik
 Modulhandbuch (180 ECTS-Punkte) Auf Basis der Prüfungs- und Studienordnung vom 31. Januar 2007 82/128/---/H0/H/2006 Stand: 13.06.2013 Inhaltsverzeichnis Abkürzungen und Erklärungen... 3 Modul: P 1 Mechanik
Modulhandbuch (180 ECTS-Punkte) Auf Basis der Prüfungs- und Studienordnung vom 31. Januar 2007 82/128/---/H0/H/2006 Stand: 13.06.2013 Inhaltsverzeichnis Abkürzungen und Erklärungen... 3 Modul: P 1 Mechanik
oder Klausur (60-90 Min.) Päd 4 Päd. Arbeitsfelder und Handlungsformen*) FS Vorlesung: Pädagogische Institutionen und Arbeitsfelder (2 SWS)
 Module im Bachelorstudium Pädagogik 1. Überblick 2. Modulbeschreibungen (ab S. 3) Modul ECTS Prüfungs- oder Studienleistung Päd 1 Modul Einführung in die Pädagogik *) 10 1. FS Vorlesung: Einführung in
Module im Bachelorstudium Pädagogik 1. Überblick 2. Modulbeschreibungen (ab S. 3) Modul ECTS Prüfungs- oder Studienleistung Päd 1 Modul Einführung in die Pädagogik *) 10 1. FS Vorlesung: Einführung in
Elementare Wirtschaftsmathematik
 Rainer Göb Elementare Wirtschaftsmathematik Erster Teil: Funktionen von einer und zwei Veränderlichen Mit 87 Abbildungen Methodica-Verlag Veitshöchheim Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen: Mengen, Tupel, Relationen.
Rainer Göb Elementare Wirtschaftsmathematik Erster Teil: Funktionen von einer und zwei Veränderlichen Mit 87 Abbildungen Methodica-Verlag Veitshöchheim Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen: Mengen, Tupel, Relationen.
Die Reaktionsentropie 96 Mischungen flüchtiger Flüssigkeiten 157 Die Spontaneität von Reaktionen Siedediagramme 157 Die Destillation von
 Inhalt 1. Eigenschaften von Gasen 1 2. Thermodynamik: der Erste Hauptsatz 43 Die Beschreibung der Zustände der Materie Die Erhaltung der Energie 44 1.1 Die Beschreibung von Zuständen 3 2.1 Arbeit und Wärme
Inhalt 1. Eigenschaften von Gasen 1 2. Thermodynamik: der Erste Hauptsatz 43 Die Beschreibung der Zustände der Materie Die Erhaltung der Energie 44 1.1 Die Beschreibung von Zuständen 3 2.1 Arbeit und Wärme
Prüfungsordnung für den Studiengang Bachelor of Science (B.Sc.)
 Nichtamtliche Lesefassung des JSL Vom 31. August 2010 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 41, Nr. 72, S. 401 503) in der Fassung vom 21. Dezember 2015 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 46, Nr. 76, S. 437 462)
Nichtamtliche Lesefassung des JSL Vom 31. August 2010 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 41, Nr. 72, S. 401 503) in der Fassung vom 21. Dezember 2015 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 46, Nr. 76, S. 437 462)
Veröffentlicht im Nachrichtenblatt: MWV Schl.-H. 2006, S. 421
 Veröffentlicht im Nachrichtenblatt: MWV Schl.-H. 2006, S. 421 Prüfungs- und Studienordnung (Satzung) des Fachbereichs Technik für den Bachelor-Studiengang Biotechnologie- an der Fachhochschule Flensburg
Veröffentlicht im Nachrichtenblatt: MWV Schl.-H. 2006, S. 421 Prüfungs- und Studienordnung (Satzung) des Fachbereichs Technik für den Bachelor-Studiengang Biotechnologie- an der Fachhochschule Flensburg
Liste der Formelzeichen. A. Thermodynamik der Gemische 1
 Inhaltsverzeichnis Liste der Formelzeichen XV A. Thermodynamik der Gemische 1 1. Grundbegriffe 3 1.1 Anmerkungen zur Nomenklatur von Mischphasen.... 4 1.2 Maße für die Zusammensetzung von Mischphasen....
Inhaltsverzeichnis Liste der Formelzeichen XV A. Thermodynamik der Gemische 1 1. Grundbegriffe 3 1.1 Anmerkungen zur Nomenklatur von Mischphasen.... 4 1.2 Maße für die Zusammensetzung von Mischphasen....
Mathematik-2, Sommersemester 2014-15
 Mathematik-2, Sommersemester 2014-15 Vorlesungsplan, Übungen, Hausaufgaben Vorlesungen: Lubov Vassilevskaya Übungen: Andreas Hofmann, Solvier Schüßler, Ansgar Schwarz, Lubov Vassilevskaya Die Vorlesungsunterlagen
Mathematik-2, Sommersemester 2014-15 Vorlesungsplan, Übungen, Hausaufgaben Vorlesungen: Lubov Vassilevskaya Übungen: Andreas Hofmann, Solvier Schüßler, Ansgar Schwarz, Lubov Vassilevskaya Die Vorlesungsunterlagen
Modulbeschreibung: Fachbachelor Griechisch (Beifach)
 Modulbeschreibung: Fachbachelor Griechisch (Beifach) Modul Aufbau 1 390 h 13 LP 1. + Sem 2 Semester a) Sprachpraxis 1 2 SWS/21 h 102 h 4 LP b) Lektüre für Anfänger 2 SWS/21h 102 h 3 LP c) Vorlesung Griechische
Modulbeschreibung: Fachbachelor Griechisch (Beifach) Modul Aufbau 1 390 h 13 LP 1. + Sem 2 Semester a) Sprachpraxis 1 2 SWS/21 h 102 h 4 LP b) Lektüre für Anfänger 2 SWS/21h 102 h 3 LP c) Vorlesung Griechische
Multiple-Choice Test. Alle Fragen können mit Hilfe der Versuchsanleitung richtig gelöst werden.
 PCG-Grundpraktikum Versuch 1- Dampfdruckdiagramm Multiple-Choice Test Zu jedem Versuch im PCG wird ein Vorgespräch durchgeführt. Für den Versuch Dampfdruckdiagramm wird dieses Vorgespräch durch einen Multiple-Choice
PCG-Grundpraktikum Versuch 1- Dampfdruckdiagramm Multiple-Choice Test Zu jedem Versuch im PCG wird ein Vorgespräch durchgeführt. Für den Versuch Dampfdruckdiagramm wird dieses Vorgespräch durch einen Multiple-Choice
Fachbereich Mathematik
 Qualifikationsphase Leistungskurse 12. und 13. Schuljahr (Abitur nach 13 Schuljahren) Semesterübersicht Semester 12. und 13. Schuljahr Leistungskursfach Gewichtung 1 Differentialrechnung I 2/3 Integralrechnung
Qualifikationsphase Leistungskurse 12. und 13. Schuljahr (Abitur nach 13 Schuljahren) Semesterübersicht Semester 12. und 13. Schuljahr Leistungskursfach Gewichtung 1 Differentialrechnung I 2/3 Integralrechnung
Prüfungsleistungen (Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten)
 Modulbeschreibung Code IV.3. Modulbezeichnung Operations Research (WiSe 2015/2016) Beitrag des Moduls zu den Studienzielen Qualifikationsziele (vgl. Leitfaden Punkt 3) Übergeordnetes Ziel des Moduls besteht
Modulbeschreibung Code IV.3. Modulbezeichnung Operations Research (WiSe 2015/2016) Beitrag des Moduls zu den Studienzielen Qualifikationsziele (vgl. Leitfaden Punkt 3) Übergeordnetes Ziel des Moduls besteht
Überblick. Kapitel 7: Anwendungen der Differentialrechnung
 Überblick Kapitel 7: Anwendungen der Differentialrechnung 1 Beispiel 1: Kapitel 7.1: Implizites Differenzieren 1 Beispiel 1: Steigung der Tangente Kapitel 7.1: Implizites Differenzieren 2 Beispiel 1: Steigung
Überblick Kapitel 7: Anwendungen der Differentialrechnung 1 Beispiel 1: Kapitel 7.1: Implizites Differenzieren 1 Beispiel 1: Steigung der Tangente Kapitel 7.1: Implizites Differenzieren 2 Beispiel 1: Steigung
Analysis Leistungskurs
 Universität Hannover September 2007 Unikik Dr. Gerhard Merziger Analysis Leistungskurs Themen Grundlagen, Beweistechniken Abbildungen (surjektiv, injektiv, bijektiv) Vollständige Induktion Wichtige Ungleichungen
Universität Hannover September 2007 Unikik Dr. Gerhard Merziger Analysis Leistungskurs Themen Grundlagen, Beweistechniken Abbildungen (surjektiv, injektiv, bijektiv) Vollständige Induktion Wichtige Ungleichungen
Thermodynamik. Springer. Peter Stephan Karlheinz Schaber Karl Stephan Franz Mayinger. Grundlagen und technische Anwendungen Band 1: Einstoffsysteme
 Peter Stephan Karlheinz Schaber Karl Stephan Franz Mayinger Thermodynamik Grundlagen und technische Anwendungen Band 1: Einstoffsysteme 16., vollständig neu bearbeitete Auflage Mit 195 Abbildungen und
Peter Stephan Karlheinz Schaber Karl Stephan Franz Mayinger Thermodynamik Grundlagen und technische Anwendungen Band 1: Einstoffsysteme 16., vollständig neu bearbeitete Auflage Mit 195 Abbildungen und
Grundlagen, Vorgehensweisen, Aufgaben, Beispiele
 Hans Benker - Wirtschaftsmathematik Problemlösungen mit EXCEL Grundlagen, Vorgehensweisen, Aufgaben, Beispiele Mit 138 Abbildungen vieweg TEIL I: EXCEL 1 EXCEL: Einführung 1 1.1 Grundlagen 1 1.1.1 Tabellenkalkulation
Hans Benker - Wirtschaftsmathematik Problemlösungen mit EXCEL Grundlagen, Vorgehensweisen, Aufgaben, Beispiele Mit 138 Abbildungen vieweg TEIL I: EXCEL 1 EXCEL: Einführung 1 1.1 Grundlagen 1 1.1.1 Tabellenkalkulation
Modulhandbuch für das Studienfach Kunstwissenschaft im Zwei-Fach-Bachelor-Studiengang an der Universität Duisburg-Essen
 1 Modulhandbuch für das Studienfach Kunstwissenschaft im Zwei-Fach-Bachelor-Studiengang an der Universität Duisburg-Essen Modulname Modulcode Modul 1: Grundlagen Modulverantwortliche/r Dr. Alma-Elisa Kittner
1 Modulhandbuch für das Studienfach Kunstwissenschaft im Zwei-Fach-Bachelor-Studiengang an der Universität Duisburg-Essen Modulname Modulcode Modul 1: Grundlagen Modulverantwortliche/r Dr. Alma-Elisa Kittner
Vereinbarungen zum Studium der technischen Anwendungsfächer
 B.Sc. Vereinbarungen zum Studium der technischen Anwendungsfächer Fachbereich Mathematik/Informatik Universität Bremen Stand: 0.0.200 Studium des technischen Anwendungsfaches Elektrotechnik er, die das
B.Sc. Vereinbarungen zum Studium der technischen Anwendungsfächer Fachbereich Mathematik/Informatik Universität Bremen Stand: 0.0.200 Studium des technischen Anwendungsfaches Elektrotechnik er, die das
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler I
 Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler I Prof. Dr. Rainer Göb* und Dipl.-Math. Kristina Lurz** Institut für Mathematik Lehrstuhl für Mathematik VIII, Statistik Universität Würzburg Sanderring 2 97070
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler I Prof. Dr. Rainer Göb* und Dipl.-Math. Kristina Lurz** Institut für Mathematik Lehrstuhl für Mathematik VIII, Statistik Universität Würzburg Sanderring 2 97070
Mathematik für Techniker
 Mathematik für Techniker 5. Auflage mit 468 Bildern, 531 Beispielen und 577 Aufgaben mit Lösungen rs Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag Inhaltsverzeichnis 1 Rechenoperationen 15 1.1 Grundbegriffe
Mathematik für Techniker 5. Auflage mit 468 Bildern, 531 Beispielen und 577 Aufgaben mit Lösungen rs Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag Inhaltsverzeichnis 1 Rechenoperationen 15 1.1 Grundbegriffe
Schulinternes Curriculum Mathematik SII
 Schulinternes Curriculum Mathematik SII Koordinatengeometrie Gerade, Parabel, Kreis Lösen von LGS mithilfe des Gaußverfahrens zur Bestimmung von Geraden und Parabeln 11 Differentialrechnung ganzrationaler
Schulinternes Curriculum Mathematik SII Koordinatengeometrie Gerade, Parabel, Kreis Lösen von LGS mithilfe des Gaußverfahrens zur Bestimmung von Geraden und Parabeln 11 Differentialrechnung ganzrationaler
Historisches Seminar. Bachelor of Arts, Nebenfach. Geschichte. Modulhandbuch. Stand:
 Historisches Seminar Bachelor of Arts, Nebenfach Geschichte Modulhandbuch Stand: 01.10.2013 1 Modul: M 1 Einführung in das Fachstudium (6 ECTS-Punkte) 1 Einführung in die V, P 6 3 4 Jedes 2. Semester Geschichtswissenschaft
Historisches Seminar Bachelor of Arts, Nebenfach Geschichte Modulhandbuch Stand: 01.10.2013 1 Modul: M 1 Einführung in das Fachstudium (6 ECTS-Punkte) 1 Einführung in die V, P 6 3 4 Jedes 2. Semester Geschichtswissenschaft
BACHELOR OF SCIENCE. Chemie. Zentrale Studienberatung
 STUDIENFÜHRER BACHELOR OF SCIENCE Chemie Zentrale Studienberatung . STUDIENGANG: B.SC. CHEMIE 2. ABSCHLUSS: Bachelor of Science 3. REGELSTUDIENZEIT: 6 Semester LEISTUNGSPUNKTE: STUDIENBEGINN FÜR STUDIENANFÄNGER:
STUDIENFÜHRER BACHELOR OF SCIENCE Chemie Zentrale Studienberatung . STUDIENGANG: B.SC. CHEMIE 2. ABSCHLUSS: Bachelor of Science 3. REGELSTUDIENZEIT: 6 Semester LEISTUNGSPUNKTE: STUDIENBEGINN FÜR STUDIENANFÄNGER:
Studienplan für das Nebenfach Geschichte der Naturwissenschaften im Rahmen eines Bachelorstudiengangs im Umfang von 45 Leistungspunkten
 Studienplan für das Nebenfach Geschichte der Naturwissenschaften im Rahmen eines Bachelorstudiengangs im Umfang von 45 Leistungspunkten (http://www.math.uni-hamburg.de/spag/gn/ba-nf-internet.pdf) Die Einschreibung
Studienplan für das Nebenfach Geschichte der Naturwissenschaften im Rahmen eines Bachelorstudiengangs im Umfang von 45 Leistungspunkten (http://www.math.uni-hamburg.de/spag/gn/ba-nf-internet.pdf) Die Einschreibung
Modulhandbuch. für das Fach Sprachliche Grundbildung im Bachelorstudium für das Lehramt an Grundschulen. Universität Siegen Philosophische Fakultät
 Modulhandbuch zur Fachspezifischen Bestimmung (FsB) vom 11. April 2014 (Amtliche Mitteilung Nr. 37/2014) https://www.unisiegen.de/start/news/amtliche_mitteilungen/2014/hp0001.pdf für das Fach Sprachliche
Modulhandbuch zur Fachspezifischen Bestimmung (FsB) vom 11. April 2014 (Amtliche Mitteilung Nr. 37/2014) https://www.unisiegen.de/start/news/amtliche_mitteilungen/2014/hp0001.pdf für das Fach Sprachliche
Kleine Formelsammlung zu Mathematik für Ingenieure IIA
 Kleine Formelsammlung zu Mathematik für Ingenieure IIA Florian Franzmann 5. Oktober 004 Inhaltsverzeichnis Additionstheoreme Reihen und Folgen 3. Reihen...................................... 3. Potenzreihen..................................
Kleine Formelsammlung zu Mathematik für Ingenieure IIA Florian Franzmann 5. Oktober 004 Inhaltsverzeichnis Additionstheoreme Reihen und Folgen 3. Reihen...................................... 3. Potenzreihen..................................
Physikalische Chemie 0 Klausur, 22. Oktober 2011
 Physikalische Chemie 0 Klausur, 22. Oktober 2011 Bitte beantworten Sie die Fragen direkt auf dem Blatt. Auf jedem Blatt bitte Name, Matrikelnummer und Platznummer angeben. Zu jeder der 25 Fragen werden
Physikalische Chemie 0 Klausur, 22. Oktober 2011 Bitte beantworten Sie die Fragen direkt auf dem Blatt. Auf jedem Blatt bitte Name, Matrikelnummer und Platznummer angeben. Zu jeder der 25 Fragen werden
Modulstruktur des Bachelorstudiengangs Mathematik ab WS 2014/15
 Modulstruktur des Bachelorstudiengangs Mathematik ab WS 2014/15 Im Bachelorstudiengang Mathematik wird besonderer Wert auf eine solide mathematische Grundausbildung gelegt, die die grundlegenden Kenntnisse
Modulstruktur des Bachelorstudiengangs Mathematik ab WS 2014/15 Im Bachelorstudiengang Mathematik wird besonderer Wert auf eine solide mathematische Grundausbildung gelegt, die die grundlegenden Kenntnisse
Inhaltsverzeichnis. xiii. Vorworte
 Inhaltsverzeichnis Vorworte xiii I Einführung 1 I.1 Ein paar Beispiele............................... 1 I.2 Interpretation von Schaubildern....................... 3 I.3 Mathematische Beschreibung von Abhängigkeiten.............
Inhaltsverzeichnis Vorworte xiii I Einführung 1 I.1 Ein paar Beispiele............................... 1 I.2 Interpretation von Schaubildern....................... 3 I.3 Mathematische Beschreibung von Abhängigkeiten.............
