Prüfung Öffentliches Recht I, Frühlingssemester 2014 Lösungs- und Korrekturhinweise. Aufgabe A und F: Multiple Choice-Fragen. Aufgabe B.1.
|
|
|
- Barbara Bretz
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Prüfung Öffentliches Recht I, Frühlingssemester 2014 Lösungs- und Korrekturhinweise Aufgabe A und F: Multiple Choice-Fragen (50 Punkte) Die Multiple-Choice-Fragen werden auf der Grundlage eines entsprechenden Fakultätsbeschlusses nicht allgemein veröffentlicht. Aufgabe B (16 Punkte) Aufgabe B.1 (4 Punkte) Gemäss Art. 3 BV üben die Kantone alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen worden sind. Sie müssen aufgrund der subsidiären Generalkompetenz nicht in der BV aufgelistet werden und sind originär. Auf der anderen Seite erfüllt der Bund gemäss Art. 42 Abs. 1 BV die Aufgaben, die ihm die BV zuweist. Die Bundeskompetenzen sind in der BV grundsätzlich abschliessend aufgelistet. Folglich ist zu prüfen, ob der Bund gemäss dem beschriebenen System der Kompetenzverteilung zum Erlass von Regelungen im Bereich der Sicherheit und des Polizeirechts zuständig ist. Grundlage einer Bundeskompetenz könnte Art. 57 BV sein. Art. 57 BV begründet allerdings keine Kompetenzen, sondern verweist auf anderweitig begründete Zuständigkeiten des Bundes. Grundsätzlich sind die Kantone für die innere Sicherheit ihres Gebiets verantwortlich. Man spricht von der Polizeihoheit der Kantone. Im Bereich der Sicherheit bestehen nur sehr punktuell Bundeskompetenzen, sogenannte fragmentarische Kompetenzen. Weil es sich bei Rayonverbote um (klassische) Massnahmen des Polizeirechts handelt, liegt die Regelungszuständigkeit bei den Kantonen. Es wäre dementsprechend unzulässig, die Rayonverbote auf Bundesebene zu regeln. Bemerkung: Wer Ausführungen zur Kompetenzverteilung bei B.2 anstatt bei B.1 gemacht, erhält die entsprechenden Punkte ebenfalls. 1
2 Aufgabe B.2 (12 Punkte) Tangierte Grundrechte: Es könnte der Schutzbereich der Bewegungsfreiheit gemäss Art. 10 Abs. 2 BV tangiert sein. Vom persönlichen Schutzbereich werden alle natürlichen Personen erfasst, also auch Max. In sachlicher Hinsicht schützt die Bewegungsfreiheit als Abwehrrecht vor ungerechtfertigtem Freiheitsentzug und Freiheitsbeschränkungen. Ein Freiheitsentzug liegt vor, wenn eine Person gegen ihren Willen an einem bestimmten, begrenzten Ort für eine gewisse Dauer festgehalten wird. Eine Freiheitsbeschränkung liegt vor, wenn eine Person daran gehindert wird, einen rechtlich und tatsächlich zugänglichen Ort aufzusuchen oder zu verlassen. Das Rayonverbot gegen Max stellt keinen Freiheitsentzug, aber eine Freiheitsbeschränkung dar. Er wird nicht an einem bestimmten, begrenzten Ort festgehalten, sondern von einem bestimmten, begrenzten Ort ferngehalten bzw. ausgegrenzt. Bemerkung: Eine gegenteilige Argumentation ist hier nicht möglich. Durch die Verfügung des Rayonverbots ist es Max nicht mehr möglich, an den Spieltagen die Rayons A, B und C der Stadt Z sowie die entsprechenden Rayons der anderen Städte zu betreten. Beim Rayonverbot handelt es sich um einen förmlichen, dem Staat zurechenbaren Rechtsakt. Die Intensität des Eingriffs ist als sehr hoch einzustufen, weil das Rayonverbot für eine sehr lange Zeit verfügt wurde und ein sehr grosses Gebiet umfasst. Der Schutzbereich der Bewegungsfreiheit ist somit durch die Verfügung des Rayonverbots tangiert. Ausserdem könnte der Schutzbereich der Versammlungsfreiheit gemäss Art. 22 Abs. 1 und 2 BV tangiert sein. Auch bei der Versammlungsfreiheit fallen alle natürlichen Personen in den persönlichen Schutzbereich. Folglich wird auch Max von diesem erfasst. In sachlicher Hinsicht garantiert die Versammlungsfreiheit das Recht jedes Menschen, sich mit anderen zu versammeln, um sich gemeinsam mit ihnen über politische und andere Fragen eine Meinung zu bilden oder diese gegenüber der Öffentlichkeit auszudrücken. Auch wenn sich die Versammlungsfreiheit vorwiegend auf politisch motivierte Versammlungen bezieht, sind auch freundschaftliche, wissenschaftliche, verwandtschaftliche, künstlerische, sportliche und unterhaltende Zusammenkünfte geschützt. Der Inhalt der ausgetauschten und ausgedrückten Meinungen spielt keine Rolle. Versammlungen mit einem widerrechtlichen Zweck, wie zum Beispiel zur Gewaltanwendung, werden nicht durch die Versammlungsfreiheit geschützt. Kommt es aber bei einer friedlich geplanten Versammlung wider Erwarten dennoch zu Gewaltakten, ändert das nichts am grundrechtlichen Schutz. 2
3 Max ist es aufgrund des Rayonverbots nicht mehr möglich, sich mit den Freunden aus seinem Fanclub zu treffen, um gemeinsam die Spiele zu verfolgen und über Fussball zu diskutieren. Es spielt keine Rolle, dass es sich lediglich um eine Freizeitbeschäftigung handelt, weil auch diese durch die Versammlungsfreiheit geschützt werden, falls sie einen minimalen meinungsbildenden Zweck aufweisen. Da sich Max mit seinen Freunden in einem Fanclub organisiert hat, ist zudem davon auszugehen, dass ein minimaler meinungsbildender Zweck vorliegt. Für eine Tangierung des Schutzbereichs der Versammlungsfreiheit spricht auch, dass der Fanclub gemeinsam an Auswärtsspiele reist. Der Schutzbereich der Versammlungsfreiheit ist deshalb tangiert. Bemerkung: Eine gegenteilige Argumentation in Bezug auf die Bezeichnung als Versammlung ist denkbar und wurde ebenfalls mit Punkten honoriert. Grundrechtskonkurrenz: Es handelt sich vorliegend um eine echte Grundrechtskonkurrenz. Prüfung der Verfassungskonformität des Grundrechtseingriffs: Bemerkung: Die Prüfung der Schranken gemäss Art. 36 BV kann für beide Grundrechte einzeln oder gemeinsam durchgeführt werden. Für theoretische Ausführungen zu Art. 36 Abs. 1 4 BV wurden aber nur einmal Punkte vergeben, falls eine gesonderte Prüfung durchgeführt wurde. Art. 36 Abs. 1 BV, Gesetzliche Grundlage: Erfordernis des Rechtssatzes: Die Grundrechtseinschränkung muss in einer generellabstrakten Norm vorgesehen sein, die genügend bestimmt ist. Generell ist eine Norm, wenn ein offener und unbestimmter Adressatenkreis vorliegt und abstrakt, wenn eine Vielzahl von Fällen geregelt wird. Die Bestimmtheit lässt sich nicht abstrakt festlegen, muss aber im Polizeirecht geringere Anforderungen erfüllen. Art. 4 Abs. 1 und 2 i.v.m. Art. 2 Abs. 1 lit. b Konkordat sind generell und abstrakt. Auch in Bezug auf die Bestimmtheit der Norm sind keine Probleme erkennbar. Der Eingriff muss in einem Gesetz im formellen Sinn vorgesehen sein. Das Konkordat als interkantonale Vereinbarung erfüllt diese Voraussetzung (vgl. Art. 48 Abs. 5 BV, B/G/K, Staatsrecht, 14 Rz. 14). Art. 36 Abs. 2 BV, Öffentliches Interesse und Schutz Grundrechte Dritter: Ein klassisches öffentliches Interesse ist der Schutz von Polizeigütern (öffentliche Ordnung, Sicherheit, Gesundheit, Ruhe, Sittlichkeit, Treu und Glauben). Der Zweck des Konkordats besteht gemäss dessen Art. 1 darin, Gewalt an Sportveranstaltungen frühzeitig 3
4 zu erkennen und zu bekämpfen. Das öffentliche Interesse des Rayonverbots liegt somit eindeutig im Schutz der Polizeigüter. Bemerkung: Der Sachverhalt enthält keine Hinweise darauf, dass der Schutz von Grundrechten Dritter geprüft werden musste. Wer dennoch Ausführungen dazu gemacht hat, konnte dafür maximal einen ¼ ZP erreichen. Art. 36 Abs. 3 BV, Verhältnismässigkeit: Das Rayonverbot muss geeignet sein, dass öffentliche Interesse zu verwirklichen. Dadurch, dass Max von neuralgischen Punkten ferngehalten wird, kann er bei Sportveranstaltungen nicht gewalttätig auffallen. Allerdings könnte auch argumentiert werden, dass sich die Gewalt bloss räumlich verlagert. Weil jedoch zumindest in den erfahrungsgemäss besonders heiklen Zonen, die als Rayons definiert worden sind, Gewaltakte verhindert werden, ist das Rayonverbot grundsätzlich geeignet, Max von weiteren Gewaltakten abzuhalten und dadurch die öffentliche Sicherheit zu erhöhen. Bei der Erforderlichkeit ist danach zu fragen, ob das angestrebte öffentliche Interesse auch mit einem in sachlicher, räumlicher, zeitlicher oder personeller Hinsicht milderen Mittel erreicht werden könnte. Sachlich und persönlich ist kaum ein milderes Mittel, das gleichwohl wirksam ist, denkbar. In zeitlicher Hinsicht hätte man die Maximaldauer aus Art. 4 Abs. 2 Konkordat nicht ausreizen müssen und ein weniger lange dauerndes Rayonverbot aussprechen können. Man hätte es auch nicht für den ganzen Spieltag aussprechen müssen, sondern auf einige Stunden vor und einige Stunden nach dem Spiel beschränken können. Räumlich hätte man das Rayonverbot einerseits auf das Gebiet des Stadions beschränken können, andererseits erscheint auch die Erfassung von allen Rayons an allen Austragungsorten an jedem Spieltag sehr weit. Bei der Überprüfung der Zumutbarkeit werden die betroffenen privaten Interessen gegen die öffentlichen Interessen abgewogen. Das öffentliche Interesse ist mit Blick auf das konkrete Verhalten von Max als gewichtig, aber nicht extrem hoch einzustufen: Es kommt bei Sportveranstaltungen seit Jahren durch Ausschreitungen zu massiven Störungen der öffentlichen Sicherheit. Das Interesse, dieses Gewaltproblem in den Griff zu kriegen, ist als durchaus erheblich einzustufen. Max war bisher aber immer friedlich und ist noch nie durch gewalttätiges Verhalten aufgefallen. Die Gefahr, dass er in Zukunft wieder negativ auffällt, ist deshalb eher gering. Ebenfalls von Belang ist, dass sich sein Gewaltakt gegen eine Sache und nicht gegen Personen gerichtet. Die Gefahr, die von ihm ausgeht, ist deshalb weniger gravierend, als wenn er beispielsweise eine Körperverletzung begangen hätte. Demgegenüber handelt es sich bei Max Fanclub um seinen Freundeskreis, an dessen gemeinsamen Aktivitäten während drei Jahren nicht mehr teilnehmen könnte. Ausserdem wird Max auch sonst in seinem Alltag erheblich eingeschränkt. Er kann an den Spieltagen weder den Zug benutzen noch irgendwelchen Besorgungen in der Innenstadt nachgehen. 4
5 Fazit: Das Rayonverbot ist aufgrund der langen Dauer und weil es sehr viele Rayons umfasst unverhältnismässig und Max ist in seinen Grundrechten verletzt worden. Aufgabe C (8 Punkte) Aufgabe C.1 (2 Punkte) Es wäre dem Kanton gestattet, nach einer entsprechenden Anpassung der Kantonsverfassung die beiden Ständeräte vom Kantonsparlament wählen zu lassen, weil das Wahlverfahren für die Ständeräte durch das kantonale Recht geregelt wird (Art. 150 Abs. 3 BV). Aufgabe C.2 (5 Punkte) Die Nationalräte werden nach dem Proporzverfahren in Form einer Listenwahl direkt vom Volk gewählt (Art. 149 Abs. 2 BV; Art. 40 und 41 BPR). Im Proporzverfahren werden die Sitze entsprechend dem Verhältnis der für die betreffende Liste eingegangenen Stimmen zu allen gültig eingegangenen Stimmen auf die Parteien (Listen) verteilt. Dies geschieht im Verfahren der Nationalratswahlen mittels der sog. Verteilungszahl: alle gültigen Stimmen geteilt durch Sitze plus 1. Das natürliche Quorum (Mindest-Stimmenanteil für einen Sitz in der ersten Verteilung) liegt bei nur zwei Sitzen sehr hoch, nämlich über 33 % (2+1). Weil nur zwei Sitze zu vergeben sind, es aber vermutlich mehr Parteien gibt, spielt der Proporzeffekt nicht mehr (vollständig) und mutiert faktisch zum Majorz, was v.a. die grossen Parteien begünstigt. Aufgabe C.3 (1 Punkte) Es entscheidet das Los (Art. 41 Abs. 1 lit. f BPR oder Art. 43 Abs. 3 BPR). Aufgabe D (16 Punkte) Aufgabe D.1 (6 Punkte) Nationalrat N könnte eine Motion einreichen: 5
6 Durch eine Motion wird der Bundesrat beauftragt, einen Entwurf zu einem Erlass der Bundesversammlung vorzulegen oder eine Massnahme zu treffen (Art. 120 Abs. 1 ParlG). Unzulässig ist gemäss Art. 120 Abs. 3 ParlG eine Motion, die auf eine in einem gesetzlich geordneten Verfahren zu treffende Verwaltungsverfügung oder auf einen Beschwerdeentscheid einwirken will. Dies ist hier, soweit aus dem Sachverhalt ersichtlich, nicht der Fall, somit steht die Motion als Handlungsinstrument zur Verfügung. Nationalrat N ist zudem in persönlicher Hinsicht berechtigt gemäss Art. 6 i.v.m. Art. 119 Abs. 1 ParlG, eine Motion einzureichen. Vorteile einer Motion: Der Gesetzesentwurf wird durch den Bundesrat bzw. sein Departement ausgearbeitet. Diese haben mehr Kapazitäten und können in der Regel auf ein breiteres Fachwissen zurückgreifen. Die Qualität des Erlassentwurfs ist häufig höher als bei der parlamentarischen Initiative. Behandlungspflicht. Nachteile einer Motion: Es ist lediglich ein Auftrag an den Bundesrat, der vom Bundesrat relativ frei umgesetzt werden kann. Das Parlament kann weniger direkten Einfluss nehmen. Der Nationalrat N könnte auch eine parlamentarische Initiative einreichen: Mit einer parlamentarischen Initiative kann vorgeschlagen werden, dass eine Kommission einen Entwurf für einen Erlass der Bundesversammlung ausarbeitet (Art. 107 Abs. 1 ParlG). Da gegenwärtig keine Revision des Gesetzes hängig ist, ist die parlamentarische Initiative zulässig. Nationalrat N ist zudem gemäss Art. 160 Abs. 1 BV i.v.m. Art. 6 ParlG in persönlicher Hinsicht berechtigt, eine parlamentarische Initiative einzureichen. Vorteile einer parlamentarischen Initiative: Die Gesetzgebungsfunktion des Parlaments kann unabhängig vom Bundesrat wahrgenommen werden und ist deshalb nicht auf die Kooperation von Bundesrat und Bundesverwaltung angewiesen. Es kann ein ausformulierter Regelungsentwurf eingebracht werden, der die Grundlage des Entwurfs bildet. Eine direktere Umsetzung von gesetzgeberischen Ideen ist möglich. Nachteile einer parlamentarischen Initiative: Die Kommission ist oftmals mit der vollständigen Ausarbeitung eines Entwurfs überfordert. Darunter leidet allenfalls die Qualität des Erlassentwurfs. 6
7 Bemerkungen: Die volle Punktzahl wird vergeben, wenn die parlamentarische Initiative vorgeschlagen und dieser Entscheid schlüssig begründet wird. Ein schlichter Verweis auf die zuvor erwähnten Vorteile der parlamentarischen Initiative genügt dafür nicht. Bei schlüssiger und überzeugender Begründung werden auch andere Vorschläge mit Teilpunkten honoriert. Ausführungen zum Postulat, zur Interpellation, zur Anfrage und zur Petition werden nicht mit Punkten bewertet. Es handelt sich dabei zwar auch um parlamentarische Handlungsinstrumente, es kann mit ihnen aber nicht wie hier klar beabsichtigt direkt auf die Gesetzgebung eingewirkt werden (vgl. B/G/K, Staatsrecht, 18 Rz. 83). Aufgabe D.2 (4 Punkte) Den Parlamentariern stehen grundsätzlich zwei parlamentarische Mittel zur Verfügung, um sich gegen die Vorlage zur Wehr zu setzen: Sie können zu hängigen Beratungsgegenständen Anträge stellen (Art. 76 Abs. 1 ParlG) oder bei den verschiedenen Abstimmungen, welche die Vorlage durchläuft, dagegen stimmen. Letzteres ist in den folgenden Verfahrensstadien möglich: Bei der Eintretensdebatte; bei der artikelweisen Beratung; und bei der Schlussabstimmung. Aufgabe D.3 (6 Punkte) Ständerat S und Ständerätin T können gemäss Art. 76 Abs. 1 ParlG Anträge zu einem hängigen Beratungsgegenstand einreichen. Da es sich bei Anträgen um Beratungsgegenstände handelt (vgl. Art. 71 lit. e ParlG), werden diese von Ratsmitgliedern mit der Einreichung beim Ratssekretariat anhängig gemacht (Art. 72 Abs. 1 ParlG). Liegen zu einem Abstimmungsgegenstand zwei Anträge vor, so sind sie gemäss Art. 78 Abs. 2 ParlG gegeneinander auszumehren. Liegen zum selben Abstimmungsgegenstand mehr als zwei Anträge vor, sind diese gemäss Art. 79 Abs. 1 ParlG mittels Eventualabstimmung auszumehren, bis einander zwei Anträge gegenübergestellt werden können. In casu liegen drei Anträge vor, weshalb die Abstimmung nach Art. 79 ParlG organisiert werden muss. Liegen zum selben Abstimmungsgegenstand mehr als zwei Anträge vor, sind diese mittels Eventualabstimmung auszumehren, bis einander zwei Anträge gegenübergestellt werden können (Art. 79 Abs. 1 ParlG). 7
8 Die Reihenfolge der Abstimmung ist dabei so zu gestalten, dass von den Anträgen mit der kleinsten inhaltlichen Differenz schrittweise bis zu denjenigen mit der grössten Differenz aufgestiegen werden kann (vgl. Art. 79 Abs. 2 ParlG). Wendet man diese Kriterien auf das vorliegende Beispiel an, muss zuerst über Antrag 2 und 3 abgestimmt werden, weil diese lediglich eine Änderung der Quadratmetergrösse beabsichtigen, die Ausnahme aber nicht ganz aufheben wollen, wie Antrag 1. Danach ist derjenige Antrag, der bei der Gegenüberstellung von 2 und 3 obsiegt hat, gegen Antrag 1 auszumehren. Aufgabe E (10 Punkte) Aufgabe E.1 (5 Punkte) Die blosse Streichung von Art. 190 BV würde die abstrakte Normenkontrolle gegenüber Bundesgesetzen noch nicht ermöglich. Es müsste auch Art. 189 Abs. 4 BV geändert werden, denn gemäss dieser Bestimmung können Akte der Bundesversammlung und des Bundesrates nur ausnahmsweise und gestützt auf eine gesetzliche Grundlage beim Bundesgericht angefochten werden. Weiter müsste auch Art. 82 BGG geändert werden, denn aufgrund dieser Bestimmung kann das Bundesgericht nur kantonale Erlasse der abstrakten Normenkontrolle unterziehen. Aufgabe E.2 (5 Punkte) Der Bund kennte keine Verfassungsgerichtsbarkeit als eigenständigen Gerichtszweig gegenüber Bundesgesetzen. Allerdings geniesst gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung die EMRK Vorrang gegenüber Bundesgesetzen. Dadurch hat sich eine Art indirekte Verfassungsgerichtsbarkeit gegenüber Bundesgesetzen im Bereich der Garantien der EMRK etabliert: Die Garantien der EMRK und die Grundrechte der Bundesverfassung sind zum grossen Teil deckungsgleich, wobei nur die in der EMRK enthaltenen Rechte den Massstab bilden. Die EMRK setzt auch den obersten Rechtssetzungsorganen Grenzen. Insofern ist auch die aktuelle Rechtsprechung des EGMR für die Schweiz von erheblicher Bedeutung und wird entsprechend diskutiert. Bemerkung: (Korrekte und ausführliche Ausführungen zur EMRK und der Rechtsanwendung werden mit einem ¼ Punkt bewertet.) 8
Übungen im öffentlichen Recht I Gruppen A-C und N-P. Fall 11 Rauchverbot. Bachelorstudium Rechtswissenschaft, FS 2016 lic. iur. Arlette Meienberger
 Übungen im öffentlichen Recht I Gruppen A-C und N-P Fall 11 Rauchverbot Bachelorstudium Rechtswissenschaft, FS 2016 lic. iur. Arlette Meienberger Seite 1 Übersicht I. Frage 1: Parlamentarische Handlungsinstrumente
Übungen im öffentlichen Recht I Gruppen A-C und N-P Fall 11 Rauchverbot Bachelorstudium Rechtswissenschaft, FS 2016 lic. iur. Arlette Meienberger Seite 1 Übersicht I. Frage 1: Parlamentarische Handlungsinstrumente
Bachelor-Prüfung Modul: Öffentliches Recht I
 Prof. Dr. Thomas Gächter Frühjahrssemester 2014 Bachelor-Prüfung Modul: Öffentliches Recht I 23. Juni 2014, 14.00 17.00 Uhr Dauer: 180 Minuten Allgemeine Hinweise: Kontrollieren Sie bitte sowohl bei Erhalt
Prof. Dr. Thomas Gächter Frühjahrssemester 2014 Bachelor-Prüfung Modul: Öffentliches Recht I 23. Juni 2014, 14.00 17.00 Uhr Dauer: 180 Minuten Allgemeine Hinweise: Kontrollieren Sie bitte sowohl bei Erhalt
1. Ist der Schutzbereich des Grundrechts berührt? persönlicher Schutzbereich. sachlicher Schutzbereich (geschützte Sphäre und Ansprüche)
 Prüfschema zur Zulässigkeit von Eingriffen in Freiheitsrechte 1 (Art. 36 BV) 1. Ist der Schutzbereich des Grundrechts berührt? persönlicher Schutzbereich sachlicher Schutzbereich (geschützte Sphäre und
Prüfschema zur Zulässigkeit von Eingriffen in Freiheitsrechte 1 (Art. 36 BV) 1. Ist der Schutzbereich des Grundrechts berührt? persönlicher Schutzbereich sachlicher Schutzbereich (geschützte Sphäre und
Rechtswissenschaftliches Institut. Gesetzgebung. Staatsrecht für Lehrpersonen HS 2016 Dr. Goran Seferovic Seite 1
 Gesetzgebung Staatsrecht für Lehrpersonen HS 2016 Dr. Goran Seferovic 24.10.2016 Seite 1 Übersicht der heutigen Vorlesung 1. Gesetzgebungsverfahren 2. Verfassungsrevision 3. Gesetzesbegriff 24.10.2016
Gesetzgebung Staatsrecht für Lehrpersonen HS 2016 Dr. Goran Seferovic 24.10.2016 Seite 1 Übersicht der heutigen Vorlesung 1. Gesetzgebungsverfahren 2. Verfassungsrevision 3. Gesetzesbegriff 24.10.2016
Fall 6 «Sicherheitsfirmen»
 Übungen im Öffentlichen Recht I FS16 Gruppen A-C und N-P Fall 6 «Sicherheitsfirmen» Prof. Dr. Thomas Gächter / lic. iur. Arlette Meienberger Seite 1 Themen dieser Übung Verschiedene Fragen zum Rechtsetzungsverfahren
Übungen im Öffentlichen Recht I FS16 Gruppen A-C und N-P Fall 6 «Sicherheitsfirmen» Prof. Dr. Thomas Gächter / lic. iur. Arlette Meienberger Seite 1 Themen dieser Übung Verschiedene Fragen zum Rechtsetzungsverfahren
Kleines Glossar der politischen Instrumente und Prozesse
 Kleines Glossar der politischen Instrumente und Prozesse Erstellt am: Erstellt von: Dateiname: Seiten: Freitag, 11. März 2011 MS Kleines Glossar der politischen Instrumente und Prozesse Seite 1 von 6 2010
Kleines Glossar der politischen Instrumente und Prozesse Erstellt am: Erstellt von: Dateiname: Seiten: Freitag, 11. März 2011 MS Kleines Glossar der politischen Instrumente und Prozesse Seite 1 von 6 2010
Fall 6: Private Sicherheitsfirmen
 Übungen im öffentlichen Recht I FS 2016 Fall 6: Private Sicherheitsfirmen MLaw Felix Schiller felix.schiller@rwi.uzh.ch Seite 1 Frage 1: Mit welchem parlamentarischen Instrument kann das Mitglied des Ständerates
Übungen im öffentlichen Recht I FS 2016 Fall 6: Private Sicherheitsfirmen MLaw Felix Schiller felix.schiller@rwi.uzh.ch Seite 1 Frage 1: Mit welchem parlamentarischen Instrument kann das Mitglied des Ständerates
Übungen Öffentliches Recht III
 Übungen Öffentliches Recht III Gruppen K-M und W-Z Prof. Dr. Felix Uhlmann / Dr. Julia Hänni Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Rechtsetzungslehre Universität Zürich FS 2015 Dr. Julia Hänni
Übungen Öffentliches Recht III Gruppen K-M und W-Z Prof. Dr. Felix Uhlmann / Dr. Julia Hänni Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Rechtsetzungslehre Universität Zürich FS 2015 Dr. Julia Hänni
Staatsrecht III (Modul: Öffentliches Recht I)
 Staatsrecht III (Modul: Öffentliches Recht I) Gruppe 3, Veranstaltungsnummer 100 Prof. Dr. iur. Thomas Gächter Seite 1 Grundrechte: Gibt es grundlegende Unterschiede zwischen der Versammlungs- und der
Staatsrecht III (Modul: Öffentliches Recht I) Gruppe 3, Veranstaltungsnummer 100 Prof. Dr. iur. Thomas Gächter Seite 1 Grundrechte: Gibt es grundlegende Unterschiede zwischen der Versammlungs- und der
Forderung Sachlicher Zusammenhang zwischen den Anliegen in derselben Vorlage (BPR 75 II) 2
 Übung: Toggenburger Separatisten Besprechung vom 1. Juni 2010 Prof. Christine Kaufmann [Vertretung: Florian Utz] Frage 1: Einheit der Materie (1/5) Zweck Gewährleistung der unverfälschten Stimmabgabe Rechtsgrundlage
Übung: Toggenburger Separatisten Besprechung vom 1. Juni 2010 Prof. Christine Kaufmann [Vertretung: Florian Utz] Frage 1: Einheit der Materie (1/5) Zweck Gewährleistung der unverfälschten Stimmabgabe Rechtsgrundlage
Fall 6 «Sicherheitsfirmen»
 Fall 6 «Sicherheitsfirmen» Übungen im Öffentlichen Recht I FS 2015 Patrizia Attinger, MLaw 06.04.2016 Seite 1 Frage 1 Mit welchem parlamentarischen Instrument kann das Mitglied des Ständerates dies erreichen?
Fall 6 «Sicherheitsfirmen» Übungen im Öffentlichen Recht I FS 2015 Patrizia Attinger, MLaw 06.04.2016 Seite 1 Frage 1 Mit welchem parlamentarischen Instrument kann das Mitglied des Ständerates dies erreichen?
Prof. Dr. A. Ruch, ETH Zürich. Heutige Stunde. Tragweite Art. 49 BV Willkürverbot Art. 9 BV Treu und Glauben Art. 9 BV
 Heutige Stunde Tragweite Art. 49 BV Willkürverbot Art. 9 BV Treu und Glauben Art. 9 BV Nachtrag zu 5.3.08 Handlungsinstrumente des Parlaments Aufträge Art. 171 BV Motion Postulat Interpellation Anfrage
Heutige Stunde Tragweite Art. 49 BV Willkürverbot Art. 9 BV Treu und Glauben Art. 9 BV Nachtrag zu 5.3.08 Handlungsinstrumente des Parlaments Aufträge Art. 171 BV Motion Postulat Interpellation Anfrage
Assessmentprüfung vom 10. Januar 2013, Öffentliches Recht I. Musterlösung
 Assessmentprüfung vom 10. Januar 2013, Öffentliches Recht I Musterlösung Vorbemerkung: Für von der Musterlösung abweichende Lösungen werden ebenfalls Punkte erteilt, wenn die Lösungen gut begründet wurden.
Assessmentprüfung vom 10. Januar 2013, Öffentliches Recht I Musterlösung Vorbemerkung: Für von der Musterlösung abweichende Lösungen werden ebenfalls Punkte erteilt, wenn die Lösungen gut begründet wurden.
Fall Nr. 12: Burkaverbot
 Übungen im Öffentlichen Recht I Gruppe A-C und N-P Fall Nr. 12: Burkaverbot Prof. Dr. Thomas Gächter Seite 1 Folie von Prof. D. Moeckli Seite 2 Seite 3 Grundrechtsbindung der BPG AG (I) Grundrechte binden
Übungen im Öffentlichen Recht I Gruppe A-C und N-P Fall Nr. 12: Burkaverbot Prof. Dr. Thomas Gächter Seite 1 Folie von Prof. D. Moeckli Seite 2 Seite 3 Grundrechtsbindung der BPG AG (I) Grundrechte binden
Gesetzgebungsverfahren
 Gesetzgebungsverfahren RVOG 57 Expertenkommission Expertenentwurf vorparlamentarische Phase (RVOG 7) BV 177 II Departement Vorentwurf BV 147 VlG 3 ff. Bundesrat Vernehmlassung (Kantone, Parteien, interessierte
Gesetzgebungsverfahren RVOG 57 Expertenkommission Expertenentwurf vorparlamentarische Phase (RVOG 7) BV 177 II Departement Vorentwurf BV 147 VlG 3 ff. Bundesrat Vernehmlassung (Kantone, Parteien, interessierte
Lösungsraster: Staatsorganisationsrecht; Prüfung Master PMP HS Frage 1 Lösung Punkte max.
 Frage 1 Lösung Ordnen Sie das folgende Dokument so genau - Es handelt sich um eine Verordnung, die sich in der systematischen Sammlung (SR) findet. Deshalb wie möglich in die Typologie der Verordnungen
Frage 1 Lösung Ordnen Sie das folgende Dokument so genau - Es handelt sich um eine Verordnung, die sich in der systematischen Sammlung (SR) findet. Deshalb wie möglich in die Typologie der Verordnungen
Politische Strukturen der Schweiz. 03 / Politik
 Politische Strukturen der Schweiz 03 / Politik Nationalrat Sitzverteilung nach Kantonen 03 / Politik Sitzverteilung nach Fraktionen Die Bundesversammlung ist politisch in Fraktionen und nicht in Parteien
Politische Strukturen der Schweiz 03 / Politik Nationalrat Sitzverteilung nach Kantonen 03 / Politik Sitzverteilung nach Fraktionen Die Bundesversammlung ist politisch in Fraktionen und nicht in Parteien
Deutsches Staatsrecht
 Ausgabe 2008-07 Deutsches Staatsrecht Grundrechte Grundrechte, Grundpflichten, Menschenrechte Als Grundrechte bezeichnet man ein System von Rechten, die der Einzelne kraft seiner Natur als freigeborener
Ausgabe 2008-07 Deutsches Staatsrecht Grundrechte Grundrechte, Grundpflichten, Menschenrechte Als Grundrechte bezeichnet man ein System von Rechten, die der Einzelne kraft seiner Natur als freigeborener
AG Staatsrecht II - Grundrechte. Korrektur Probeklausur, vgl. NJW 2011,
 AG Staatsrecht II - Grundrechte Korrektur Probeklausur, vgl. NJW 2011, 1201-1211 Die Verfassungsbeschwerde hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und soweit sie begründet ist. A./ Zulässigkeit I./
AG Staatsrecht II - Grundrechte Korrektur Probeklausur, vgl. NJW 2011, 1201-1211 Die Verfassungsbeschwerde hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und soweit sie begründet ist. A./ Zulässigkeit I./
Wer verfügt auf Bundesebene über ein Gesetzesinitiativrecht?
 Massgebende Erlasse Bundesverfassung (SR 101) Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG; SR 172.010) Bundesgesetz über das Vernehmlassungsverfahren (SR 172.061) Verordnung über das Vernehmlassungsverfahren
Massgebende Erlasse Bundesverfassung (SR 101) Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG; SR 172.010) Bundesgesetz über das Vernehmlassungsverfahren (SR 172.061) Verordnung über das Vernehmlassungsverfahren
Fall 2 Klosterplatz. Themen dieser Übung. lic. iur. Arlette Meienberger
 Fall 2 Klosterplatz Übungen im Öffentlichen Recht I FS 2016 Gruppe A-C und N-P lic. iur. Arlette Meienberger arlette.meienberger@rwi.uzh.ch Seite 1 Themen dieser Übung Zum Vorgehen bei einer Falllösung
Fall 2 Klosterplatz Übungen im Öffentlichen Recht I FS 2016 Gruppe A-C und N-P lic. iur. Arlette Meienberger arlette.meienberger@rwi.uzh.ch Seite 1 Themen dieser Übung Zum Vorgehen bei einer Falllösung
Kompetenzverteilung Bund/Kantone. Übersicht. Grundsatz von Art. 3 BV (1/3) Staatsrecht II Vorlesung vom 30. März 2010
 Kompetenzverteilung Bund/Kantone Vorlesung vom 30. März 2010 Frühjahrssemester 2010 Prof. Christine Kaufmann Übersicht Grundsätzliche Regelung der Kompetenzausscheidung Überblick über die Kompetenzen des
Kompetenzverteilung Bund/Kantone Vorlesung vom 30. März 2010 Frühjahrssemester 2010 Prof. Christine Kaufmann Übersicht Grundsätzliche Regelung der Kompetenzausscheidung Überblick über die Kompetenzen des
Rechtswissenschaftliches Institut. Rechtsweggarantie
 Rechtsweggarantie Schutzbereich Art. 29a BV Anspruch auf effektiven Rechtsschutz in allen Rechtsstreitigkeiten für natürliche und juristische Personen o Rechtstreitigkeit liegt vor, wenn ein Sachverhalt
Rechtsweggarantie Schutzbereich Art. 29a BV Anspruch auf effektiven Rechtsschutz in allen Rechtsstreitigkeiten für natürliche und juristische Personen o Rechtstreitigkeit liegt vor, wenn ein Sachverhalt
Übungen im Öffentlichen Recht III (Gruppen D F und Q S) Fall 2 Prof. A. Griffel - Übungen im Öffentlichen Recht III - Frühjahrssemester 2017 Folie 2
 Übungen im Öffentlichen Recht III (Gruppen D F und Q S) Fall 2 Prof. A. Griffel - Übungen im Öffentlichen Recht III - Frühjahrssemester 2017 Folie 2 I. Anfechtbarkeit des Entscheids des Rektors auf kantonaler
Übungen im Öffentlichen Recht III (Gruppen D F und Q S) Fall 2 Prof. A. Griffel - Übungen im Öffentlichen Recht III - Frühjahrssemester 2017 Folie 2 I. Anfechtbarkeit des Entscheids des Rektors auf kantonaler
Fall 9 (Marco Donatsch, 21./22. November 2011)
 Fall 9 (Marco Donatsch, 21./22. November 2011) Analyse des Sachverhalts: kantonale Rekursinstanz bewilligt dauernde Verlängerung der Schliessungsstunde gemäss Rekurs Unternehmen A: ganzjährig Donnerstag/Sonntag
Fall 9 (Marco Donatsch, 21./22. November 2011) Analyse des Sachverhalts: kantonale Rekursinstanz bewilligt dauernde Verlängerung der Schliessungsstunde gemäss Rekurs Unternehmen A: ganzjährig Donnerstag/Sonntag
Bundesverfassung Reform 2012
 Bundesverfassung Reform 2012 Neu: Blau Streichen: Rot Nicht erwähnte Artikel und Punkte bleiben wie Bestehend. (Bemerkungen: Kursiv) Bundesverfassung Der Schweizerischen Eidgenossenschaft Präambel (Religions-Neutral)
Bundesverfassung Reform 2012 Neu: Blau Streichen: Rot Nicht erwähnte Artikel und Punkte bleiben wie Bestehend. (Bemerkungen: Kursiv) Bundesverfassung Der Schweizerischen Eidgenossenschaft Präambel (Religions-Neutral)
Atomkraft nein danke! Lösungsskizze. Vorab: Festlegung der zu prüfenden hoheitlichen Maßnahme: Verbotsverfügung
 AG GRUNDRECHTE SS 2015 2. Termin, 29.4.2015 Art. 8 GG Atomkraft nein danke! Lösungsskizze Vorab: Festlegung der zu prüfenden hoheitlichen Maßnahme: Verbotsverfügung = Einzelakt. A. Verletzung von Art.
AG GRUNDRECHTE SS 2015 2. Termin, 29.4.2015 Art. 8 GG Atomkraft nein danke! Lösungsskizze Vorab: Festlegung der zu prüfenden hoheitlichen Maßnahme: Verbotsverfügung = Einzelakt. A. Verletzung von Art.
DAS POLITISCHE SYSTEM DER SCHWEIZ (stark vereinfacht)
 DAS POLITISCHE SYSTEM DER SCHWEIZ (stark vereinfacht) Rechtsschutz Wahl Vereinigte Bundesversammlung (246) Wahl Bundesrat (7) Initiative Oberaufsicht Nationalrat Ständerat (200) (46) Bundesversammlung
DAS POLITISCHE SYSTEM DER SCHWEIZ (stark vereinfacht) Rechtsschutz Wahl Vereinigte Bundesversammlung (246) Wahl Bundesrat (7) Initiative Oberaufsicht Nationalrat Ständerat (200) (46) Bundesversammlung
Allgemeine Übersicht. Staatliches Handeln
 Allgemeine Übersicht (FBstaatsrecht 14-I) Staatliches Handeln Rechtsakte Realakte i.w.s. Rechtssätze Rechtsanwendung Vertragl. Handeln Auskunft, Empfehlung, Information ies Staatsvertrag ÖR- 1 Vertrag
Allgemeine Übersicht (FBstaatsrecht 14-I) Staatliches Handeln Rechtsakte Realakte i.w.s. Rechtssätze Rechtsanwendung Vertragl. Handeln Auskunft, Empfehlung, Information ies Staatsvertrag ÖR- 1 Vertrag
Schweizer Bürgerrecht. 6. und 9. Dezember 2011 PD Patricia Schiess Herbstsemester 2011
 Schweizer Bürgerrecht 6. und 9. Dezember 2011 PD Patricia Schiess Herbstsemester 2011 Historische Entwicklung Kantonsbürgerrecht als primäres Bürgerrecht Art. 42 BV von 1848: Jeder Kantonsbürger ist Schweizerbürger.
Schweizer Bürgerrecht 6. und 9. Dezember 2011 PD Patricia Schiess Herbstsemester 2011 Historische Entwicklung Kantonsbürgerrecht als primäres Bürgerrecht Art. 42 BV von 1848: Jeder Kantonsbürger ist Schweizerbürger.
Parlamentarische Initiative Erneute Verlängerung der kantonalen Zulassung von Arzneimitteln
 12.471 Parlamentarische Initiative Erneute Verlängerung der kantonalen Zulassung von Arzneimitteln Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 26. April 2013 Sehr
12.471 Parlamentarische Initiative Erneute Verlängerung der kantonalen Zulassung von Arzneimitteln Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 26. April 2013 Sehr
Allgemeines Verwaltungsrecht
 Prof. Dr. Felix Uhlmann Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Rechtsetzungslehre AVR 3 Universität Zürich Prof. Dr. Felix Uhlmann 1 Zeitlicher und räumlicher Geltungsbereich 5 des Verwaltungsrechts
Prof. Dr. Felix Uhlmann Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Rechtsetzungslehre AVR 3 Universität Zürich Prof. Dr. Felix Uhlmann 1 Zeitlicher und räumlicher Geltungsbereich 5 des Verwaltungsrechts
Bundesversammlung. Ziele. Repetition: Legislative (1/3) Staatsrecht II Vorlesungen vom 4./11. Mai 2010
 Bundesversammlung Vorlesungen vom 4./11. Mai 2010 Frühjahrssemester 2010 Prof. Christine Kaufmann Ziele Allgemeine Funktionen und Organisation der Legislative verstehen und auf die Schweiz anwenden Zweikammersystem
Bundesversammlung Vorlesungen vom 4./11. Mai 2010 Frühjahrssemester 2010 Prof. Christine Kaufmann Ziele Allgemeine Funktionen und Organisation der Legislative verstehen und auf die Schweiz anwenden Zweikammersystem
über die interkantonalen Verträge (VertragsG)
 . Gesetz vom. September 009 über die interkantonalen Verträge (VertragsG) Der Grosse Rat des Kantons Freiburg gestützt auf die Bundesverfassung vom 8. April 999, namentlich die Artikel 48, 7, 86 Abs. und
. Gesetz vom. September 009 über die interkantonalen Verträge (VertragsG) Der Grosse Rat des Kantons Freiburg gestützt auf die Bundesverfassung vom 8. April 999, namentlich die Artikel 48, 7, 86 Abs. und
Die einzelnen Freiheitsrechte III. Ziele. Eigentumsgarantie: Allgemeines. Staatsrecht I. Vorlesungen vom 30. Okt./3.Nov.
 Die einzelnen Freiheitsrechte III Vorlesungen vom 30. Okt./3. Nov. 2009 Herbstsemester 2009 Prof. Christine Kaufmann Ziele Funktion und Zielsetzung der Eigentumsgarantie und der Wirtschaftsfreiheit verstehen
Die einzelnen Freiheitsrechte III Vorlesungen vom 30. Okt./3. Nov. 2009 Herbstsemester 2009 Prof. Christine Kaufmann Ziele Funktion und Zielsetzung der Eigentumsgarantie und der Wirtschaftsfreiheit verstehen
Übungen im Öffentlichen Recht II (Gruppen D F und Q S) Fall 3 Prof. A. Griffel - Übungen im Öffentlichen Recht II - Herbstsemester 2012 Folie 1
 Übungen im Öffentlichen Recht II (Gruppen D F und Q S) Fall 3 Prof. A. Griffel - Übungen im Öffentlichen Recht II - Herbstsemester 2012 Folie 1 I. Anfechtbarkeit des Entscheids des Rektors auf kantonaler
Übungen im Öffentlichen Recht II (Gruppen D F und Q S) Fall 3 Prof. A. Griffel - Übungen im Öffentlichen Recht II - Herbstsemester 2012 Folie 1 I. Anfechtbarkeit des Entscheids des Rektors auf kantonaler
Rechtsetzungslehre. Prof. Dr. Felix Uhlmann. Universität Zürich HS Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Rechtsetzungslehre
 Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Universität Zürich Redaktion und Überprüfung 8 Impuls Konzept Kernteam Verwaltung Öffentlichkeit Konkretisierung Rückmeldungen Rückmeldungen Redaktion Überprüfung
Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Universität Zürich Redaktion und Überprüfung 8 Impuls Konzept Kernteam Verwaltung Öffentlichkeit Konkretisierung Rückmeldungen Rückmeldungen Redaktion Überprüfung
Bundesstaatsrecht Übung III
 Dr. Benedikt van Spyk Bundesstaatsrecht Übung III 23. März 2012 Repetition 1 Was verstehen Sie unter Methodenpluralismus? Repetition 1 Methodenpluralismus: «Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung
Dr. Benedikt van Spyk Bundesstaatsrecht Übung III 23. März 2012 Repetition 1 Was verstehen Sie unter Methodenpluralismus? Repetition 1 Methodenpluralismus: «Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung
Übungen im öffentlichen Recht I Fall 5
 Übungen im öffentlichen Recht I Fall 5 Bachelorstudium Rechtswissenschaft, FS 2015 MLaw Gregori Werder Seite 1 Übersicht I. Sachverhalt II. Lösung III. Lernkontrolle Seite 2 1 Lernziele Sie verstehen die
Übungen im öffentlichen Recht I Fall 5 Bachelorstudium Rechtswissenschaft, FS 2015 MLaw Gregori Werder Seite 1 Übersicht I. Sachverhalt II. Lösung III. Lernkontrolle Seite 2 1 Lernziele Sie verstehen die
Übungen Öffentliches Recht II
 Gruppen K-M und W-Z Prof. Dr. Felix Uhlmann Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Rechtsetzungslehre Universität Zürich Prof. Dr. Felix Uhlmann 1 Fall 5 Industrielle Werke und das Sprudelwasser
Gruppen K-M und W-Z Prof. Dr. Felix Uhlmann Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Rechtsetzungslehre Universität Zürich Prof. Dr. Felix Uhlmann 1 Fall 5 Industrielle Werke und das Sprudelwasser
Gewaltenteilung/Bundesbehörden. Übersicht. Schweizerisches System: Merkmale. Staatsrecht II Vorlesung vom 27. April 2010
 Gewaltenteilung/Bundesbehörden Vorlesung vom 27. April 2010 Frühjahrssemester 2010 Prof. Christine Kaufmann Übersicht Fortsetzung letzte Stunde: Politische Systeme Gewaltenteilung Rekapitulation: Gewaltenteilungslehre
Gewaltenteilung/Bundesbehörden Vorlesung vom 27. April 2010 Frühjahrssemester 2010 Prof. Christine Kaufmann Übersicht Fortsetzung letzte Stunde: Politische Systeme Gewaltenteilung Rekapitulation: Gewaltenteilungslehre
Propädeutische Übung Verfassungsrecht, Grundkurs II Sommersemester A. Allgemeines
 Propädeutische Übung Verfassungsrecht, Grundkurs II Sommersemester 2005 A. Allgemeines I. Grundrechte im Grundgesetz Regelung der Grundrechte in den Art. 1 bis 19 GG Regelung grundrechtsgleicher Rechte
Propädeutische Übung Verfassungsrecht, Grundkurs II Sommersemester 2005 A. Allgemeines I. Grundrechte im Grundgesetz Regelung der Grundrechte in den Art. 1 bis 19 GG Regelung grundrechtsgleicher Rechte
Die einzelnen Freiheitsrechte 3. Teil: Wirtschaftsfreiheit und Eigentumsgarantie
 Die einzelnen Freiheitsrechte 3. Teil: Wirtschaftsfreiheit und Eigentumsgarantie Vorlesungen vom 6. und 9. November 2012 Prof. Christine Kaufmann Herbstsemester 2012 Die Wirtschaft in der BV Grundsatz
Die einzelnen Freiheitsrechte 3. Teil: Wirtschaftsfreiheit und Eigentumsgarantie Vorlesungen vom 6. und 9. November 2012 Prof. Christine Kaufmann Herbstsemester 2012 Die Wirtschaft in der BV Grundsatz
Öffentliches Verfahrensrecht
 Prof. Dr. Felix Uhlmann Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Rechtsetzungslehre ÖVR 6 Prof. Dr. Felix Uhlmann 1 Beschwerdeverfahren II (insb. Beschwerdeinstanzen) Prof. Dr. Felix Uhlmann 2
Prof. Dr. Felix Uhlmann Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Rechtsetzungslehre ÖVR 6 Prof. Dr. Felix Uhlmann 1 Beschwerdeverfahren II (insb. Beschwerdeinstanzen) Prof. Dr. Felix Uhlmann 2
Gliederungen des positiven Rechts
 Gliederungen des positiven Rechts I. Gliederung aufgrund der Normenhierarchie 1. Verfassung 2. Gesetz (im formellen Sinn) 3. Verordnung II. III. IV. Gliederung aufgrund der Hierarchie der Gemeinwesen 1.
Gliederungen des positiven Rechts I. Gliederung aufgrund der Normenhierarchie 1. Verfassung 2. Gesetz (im formellen Sinn) 3. Verordnung II. III. IV. Gliederung aufgrund der Hierarchie der Gemeinwesen 1.
AG STAATSRECHT II - GRUNDRECHTE F AL L Z W AN G S M I T G L I E D S C H AF T
 AG STAATSRECHT II - GRUNDRECHTE F AL L 1 1 - Z W AN G S M I T G L I E D S C H AF T Die Verfassungsbeschwerde des B hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und soweit sie begründet ist. A./ ZULÄSSIGKEIT
AG STAATSRECHT II - GRUNDRECHTE F AL L 1 1 - Z W AN G S M I T G L I E D S C H AF T Die Verfassungsbeschwerde des B hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und soweit sie begründet ist. A./ ZULÄSSIGKEIT
Beschwerdelegitimation der Gemeinde (E. 1.1).
 Sozialhilfe; Unterstützungswohnsitz eines Kindes unter Vormundschaft Art. 1 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 3 lit. a ZUG; Art. 25 ZGB; Art. 5 IVSE; Art. 8 Abs. 3 SHEG; Art. 57a Abs. 1 Satz 2 JG; Art. 18 Abs. 2
Sozialhilfe; Unterstützungswohnsitz eines Kindes unter Vormundschaft Art. 1 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 3 lit. a ZUG; Art. 25 ZGB; Art. 5 IVSE; Art. 8 Abs. 3 SHEG; Art. 57a Abs. 1 Satz 2 JG; Art. 18 Abs. 2
Bundesstaatlichkeit, Kompetenzverteilung
 Bundesstaatlichkeit, Kompetenzverteilung Staatsrecht für Lehrpersonen HS 2016 Dr. Goran Seferovic 29.09.2016 Seite 1 Übersicht der heutigen Vorlesung 1. Begriff des Bundesstaates 2. Der schweizerische
Bundesstaatlichkeit, Kompetenzverteilung Staatsrecht für Lehrpersonen HS 2016 Dr. Goran Seferovic 29.09.2016 Seite 1 Übersicht der heutigen Vorlesung 1. Begriff des Bundesstaates 2. Der schweizerische
3. Teil Aufgaben des Staates
 Grundzüge des Rechts (V 851-0708-00) - Übersicht 3. Teil Aufgaben des Staates Die Kompetenzordnung Grundsätze der Aufgabenerfüllung Kontrolle der Verwaltung Verantwortlichkeit Art. 3 BV Kantone Die Kantone
Grundzüge des Rechts (V 851-0708-00) - Übersicht 3. Teil Aufgaben des Staates Die Kompetenzordnung Grundsätze der Aufgabenerfüllung Kontrolle der Verwaltung Verantwortlichkeit Art. 3 BV Kantone Die Kantone
Die einzelnen Freiheitsrechte 3. Teil
 Die einzelnen Freiheitsrechte 3. Teil Vorlesungen vom 4. und 7. November 2011 Prof. Christine Kaufmann Herbstsemester 2011 Seite 1 Einleitung: Fall aus Reader Zürcher Taxifall (Entscheid 2C_940/2010) Die
Die einzelnen Freiheitsrechte 3. Teil Vorlesungen vom 4. und 7. November 2011 Prof. Christine Kaufmann Herbstsemester 2011 Seite 1 Einleitung: Fall aus Reader Zürcher Taxifall (Entscheid 2C_940/2010) Die
n Pa.Iv. Müller Philipp. Kein Familiennachzug bei Bezug von Ergänzungsleistungen
 Nationalrat Conseil national Consiglio nazionale Cussegl naziunal 08.428 n Pa.Iv. Müller Philipp. Kein Familiennachzug bei Bezug von Ergänzungsleistungen 08.450 n Pa.Iv. Müller Philipp. Mehr Handlungsspielraum
Nationalrat Conseil national Consiglio nazionale Cussegl naziunal 08.428 n Pa.Iv. Müller Philipp. Kein Familiennachzug bei Bezug von Ergänzungsleistungen 08.450 n Pa.Iv. Müller Philipp. Mehr Handlungsspielraum
STAATSBEGRIFF klassische Definition: erweiterte Definition:
 STAATSBEGRIFF klassische Definition: Der Staat ist die mit ursprünglicher Herrschermacht ausgerüstete Verbandseinheit (Körperschaft) eines sesshaften Volkes. (GEORG JELLINEK) Staatsvolk Staatsgebiet Staatsgewalt
STAATSBEGRIFF klassische Definition: Der Staat ist die mit ursprünglicher Herrschermacht ausgerüstete Verbandseinheit (Körperschaft) eines sesshaften Volkes. (GEORG JELLINEK) Staatsvolk Staatsgebiet Staatsgewalt
Die Rolle des Bundesgerichts im Gesetzgebungsprozess
 Die Rolle des Bundesgerichts im Gesetzgebungsprozess Wissenschaftliche Tagung 2016 Eine Standortbestimmung Introduction à PowerPoint 1. Einleitung Übersicht 2. Mitwirkung bei Gesetzes- und Verordnungsentwürfen
Die Rolle des Bundesgerichts im Gesetzgebungsprozess Wissenschaftliche Tagung 2016 Eine Standortbestimmung Introduction à PowerPoint 1. Einleitung Übersicht 2. Mitwirkung bei Gesetzes- und Verordnungsentwürfen
VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS ST.GALLEN
 B 2008/166 VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS ST.GALLEN Entscheid vom 11. November 2008 In Sachen X., Gesuchsteller, vertreten durch Rechtsanwalt, gegen Y., Gesuchsgegner, betreffend Akteneinsicht - 2 - hat
B 2008/166 VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS ST.GALLEN Entscheid vom 11. November 2008 In Sachen X., Gesuchsteller, vertreten durch Rechtsanwalt, gegen Y., Gesuchsgegner, betreffend Akteneinsicht - 2 - hat
Konversatorium Grundkurs Öffentliches Recht I -Staatsorganisationsrecht- Fall 4: Verlängerung der Legislaturperiode
 Universität Würzburg Wintersemester 2007/08 Konversatorium Grundkurs Öffentliches Recht I -Staatsorganisationsrecht- Fall 4: Verlängerung der Legislaturperiode In Betracht kommt eine abstrakte Normenkontrolle,
Universität Würzburg Wintersemester 2007/08 Konversatorium Grundkurs Öffentliches Recht I -Staatsorganisationsrecht- Fall 4: Verlängerung der Legislaturperiode In Betracht kommt eine abstrakte Normenkontrolle,
Nach der Herbst- ist vor der Wintersession: Status der Umsetzung der Energiestrategie 2050 und Weichenstellung für die Gebäudetechnik
 Nach der Herbst- ist vor der Wintersession: Status der Umsetzung der Energiestrategie 2050 und Weichenstellung für die Gebäudetechnik (Stephan Peterhans, dipl. HLK Ing. HTL / NDS U) Ziel 1. Berichterstattung
Nach der Herbst- ist vor der Wintersession: Status der Umsetzung der Energiestrategie 2050 und Weichenstellung für die Gebäudetechnik (Stephan Peterhans, dipl. HLK Ing. HTL / NDS U) Ziel 1. Berichterstattung
Vorlesung Staatsrecht II (Grundrechte)
 Prof. Dr. Christoph Gröpl Lehrstuhl für Staats-und Verwaltungsrecht, deutsches und europäisches Finanzund Steuerrecht Vorlesung Staatsrecht II (Grundrechte) Freizügigkeit, Art. 11 GG a) persönlich: alle
Prof. Dr. Christoph Gröpl Lehrstuhl für Staats-und Verwaltungsrecht, deutsches und europäisches Finanzund Steuerrecht Vorlesung Staatsrecht II (Grundrechte) Freizügigkeit, Art. 11 GG a) persönlich: alle
Prof. Markus Schefer/Alexandra Zimmermann Oktober 2010 Fall Sterbehilfe. Fall Sterbehilfe
 Prof. Markus Schefer/Alexandra Zimmermann 1 Fall Sterbehilfe Im Folgenden finden Sie eine äusserst knappe, zum Teil fast stichwortartige Lösungsskizze. Die Lösung im Rahmen der Prüfung muss ganz ausformuliert
Prof. Markus Schefer/Alexandra Zimmermann 1 Fall Sterbehilfe Im Folgenden finden Sie eine äusserst knappe, zum Teil fast stichwortartige Lösungsskizze. Die Lösung im Rahmen der Prüfung muss ganz ausformuliert
Rep.-Kurs Öffentliches Recht Einheit 4: Einführung in das Staatsrecht II
 Rep.-Kurs Öffentliches Recht Einheit 4: Staatsrecht II Grundrechte Was gilt es in diesem Zusammenhang zu beherrschen? 1. Allgemeine Grundrechtslehren Prüfung Freiheits- und Gleichheitsrechte Drittwirkung
Rep.-Kurs Öffentliches Recht Einheit 4: Staatsrecht II Grundrechte Was gilt es in diesem Zusammenhang zu beherrschen? 1. Allgemeine Grundrechtslehren Prüfung Freiheits- und Gleichheitsrechte Drittwirkung
Art.3 des Gesetzes regelt sodann die Abstimmungsmodalitäten, welche den Regelungen des BWahlG entsprechen.
 Sachverhalt Fall 9 Sachverhalt Der Bundestag berät einen in der Öffentlichkeit heiß diskutierten Gesetzentwurf zur Reform der sozialen Sicherungssysteme. Da die Struktur der gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung
Sachverhalt Fall 9 Sachverhalt Der Bundestag berät einen in der Öffentlichkeit heiß diskutierten Gesetzentwurf zur Reform der sozialen Sicherungssysteme. Da die Struktur der gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung
Lösungsskizze zur Probeklausur: Fahndung Hooligans
 Probeklausur Fahndung Hooligans 1 Lösungsskizze zur Probeklausur: Fahndung Hooligans I. Betroffene Grundrechte Es stellt sich gemäss vorliegendem Sachverhalt die Frage, ob die informationelle Selbstbestimmung
Probeklausur Fahndung Hooligans 1 Lösungsskizze zur Probeklausur: Fahndung Hooligans I. Betroffene Grundrechte Es stellt sich gemäss vorliegendem Sachverhalt die Frage, ob die informationelle Selbstbestimmung
Grundrechte von Minderjährigen als Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Raums
 3. Fachtagung zum Polizeirecht Grundrechte von Minderjährigen als Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Raums Markus Kern Minderjährige im öffentlichen Raum 2 Übersicht 1. Grundrechtliche Vorgaben für
3. Fachtagung zum Polizeirecht Grundrechte von Minderjährigen als Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Raums Markus Kern Minderjährige im öffentlichen Raum 2 Übersicht 1. Grundrechtliche Vorgaben für
Online-Durchsuchung Lösungsskizze. Die Verfassungsbeschwerde des E hat Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist.
 AG GRUNDRECHTE SS 2015 8. Termin, 17.6.2015, APR Online-Durchsuchung Lösungsskizze Die Verfassungsbeschwerde des E hat Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist. A. Zulässigkeit I. Zuständigkeit des
AG GRUNDRECHTE SS 2015 8. Termin, 17.6.2015, APR Online-Durchsuchung Lösungsskizze Die Verfassungsbeschwerde des E hat Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist. A. Zulässigkeit I. Zuständigkeit des
Ratschlag betreffend die Zahl der den Wahlkreisen der Stadt und den Gemeinden Bettingen und Riehen im Grossen Rat zustehenden
 An den Grossen Rat 15.1998.01 PD/P151998 Basel, 23. Dezember 2015 Regierungsratsbeschluss vom 22. Dezember 2015 Ratschlag betreffend die Zahl der den Wahlkreisen der Stadt und den Gemeinden Bettingen und
An den Grossen Rat 15.1998.01 PD/P151998 Basel, 23. Dezember 2015 Regierungsratsbeschluss vom 22. Dezember 2015 Ratschlag betreffend die Zahl der den Wahlkreisen der Stadt und den Gemeinden Bettingen und
Übungen Öffentliches Recht
 Gruppen K-M und W-Z Prof. Dr. Felix Uhlmann Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Rechtsetzungslehre Universität Zürich DBA und Bankkundengeheimnis Steigender internationaler Druck auf die Schweiz
Gruppen K-M und W-Z Prof. Dr. Felix Uhlmann Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Rechtsetzungslehre Universität Zürich DBA und Bankkundengeheimnis Steigender internationaler Druck auf die Schweiz
Justizorganisation (stark vereinfacht)
 Justizorganisation (stark vereinfacht) Bundesgericht Zivilgerichts- Strafgerichts- Soz.vers.gerichts- Verfassungs- Verwaltungsbarkeit barkeit barkeit gerichtsbarkeit gerichtsbarkeit Bundesrat 2 zivilr.
Justizorganisation (stark vereinfacht) Bundesgericht Zivilgerichts- Strafgerichts- Soz.vers.gerichts- Verfassungs- Verwaltungsbarkeit barkeit barkeit gerichtsbarkeit gerichtsbarkeit Bundesrat 2 zivilr.
n Pa.Iv. Müller Philipp. Kein Familiennachzug bei Bezug von Ergänzungsleistungen
 Nationalrat Conseil national Consiglio nazionale Cussegl naziunal 08.428 n Pa.Iv. Müller Philipp. Kein Familiennachzug bei Bezug von Ergänzungsleistungen 08.450 n Pa.Iv. Müller Philipp. Mehr Handlungsspielraum
Nationalrat Conseil national Consiglio nazionale Cussegl naziunal 08.428 n Pa.Iv. Müller Philipp. Kein Familiennachzug bei Bezug von Ergänzungsleistungen 08.450 n Pa.Iv. Müller Philipp. Mehr Handlungsspielraum
8. März und 9. März 2017 Markus Notter. Staats- und Verwaltungsrecht des Kantons Zürich
 Staats- und Verwaltungsrecht des Kantons Zürich 8. März 2018 2. und 9. März 2017 Markus Notter A. Kantonsverfassung Funktionen einer Kantonsverfassung Ausdruck kantonaler Staatlichkeit Rechtliche Grundordnung
Staats- und Verwaltungsrecht des Kantons Zürich 8. März 2018 2. und 9. März 2017 Markus Notter A. Kantonsverfassung Funktionen einer Kantonsverfassung Ausdruck kantonaler Staatlichkeit Rechtliche Grundordnung
Bachelor-Prüfung Modul: Öffentliches Recht I 4. Januar 2016
 Prof. Dr. Andreas Kley Herbstsemester 05 Bachelor-Prüfung Modul: Öffentliches Recht I 4. Januar 06 Dauer: 80 Minuten Kontrollieren Sie bitte sowohl bei Erhalt als auch bei Abgabe der Prüfung die Anzahl
Prof. Dr. Andreas Kley Herbstsemester 05 Bachelor-Prüfung Modul: Öffentliches Recht I 4. Januar 06 Dauer: 80 Minuten Kontrollieren Sie bitte sowohl bei Erhalt als auch bei Abgabe der Prüfung die Anzahl
Modul XII Staats- und Beamtenhaftung
 Modul XII Staats- und Beamtenhaftung A. Öffentliches Entschädigungsrecht Das Verwaltungshandeln kann Schäden verursachen oder anderweitige Auswirkungen auf das Vermögen haben, die im Rechtsstaat abzugelten
Modul XII Staats- und Beamtenhaftung A. Öffentliches Entschädigungsrecht Das Verwaltungshandeln kann Schäden verursachen oder anderweitige Auswirkungen auf das Vermögen haben, die im Rechtsstaat abzugelten
Die Informationsfreiheit
 5 Die Informationsfreiheit Warum ist die Informationsfreiheit neben der Meinungsfreiheit erforderlich? Hypothese: Die freie Verbreitung von Information ist hinreichend durch die Meinungsfreiheit des Senders
5 Die Informationsfreiheit Warum ist die Informationsfreiheit neben der Meinungsfreiheit erforderlich? Hypothese: Die freie Verbreitung von Information ist hinreichend durch die Meinungsfreiheit des Senders
6. Exkurs: Bedeutung des kantonalen Verwaltungsrechts 37 VI. Gewährleistung der Kantonsverfassungen 39
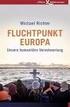 Allgemeine Literatur zum kantonalen Staatsrecht Abkürzungsverzeichnis Vorwort XI XIII XIX I.Kapitel Die Kantone im Bundesstaat 1 1 Kantonale Souveränität und Bundesstaatlichkeit 1 I. Der geschichtliche
Allgemeine Literatur zum kantonalen Staatsrecht Abkürzungsverzeichnis Vorwort XI XIII XIX I.Kapitel Die Kantone im Bundesstaat 1 1 Kantonale Souveränität und Bundesstaatlichkeit 1 I. Der geschichtliche
Modul 55104: Staats- und Verfassungsrecht
 Modul 55104: Staats- und Verfassungsrecht Besprechung der Klausur aus dem WS 2013/2014 Erfolgsaussichten der Verfassungsbeschwerde Obersatz: Die Verfassungsbeschwerde könnte Erfolg haben. Die Verfassungsbeschwerde
Modul 55104: Staats- und Verfassungsrecht Besprechung der Klausur aus dem WS 2013/2014 Erfolgsaussichten der Verfassungsbeschwerde Obersatz: Die Verfassungsbeschwerde könnte Erfolg haben. Die Verfassungsbeschwerde
Prof. Dr. Christoph Gröpl Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht, deutsches und europäisches Finanzund Steuerrecht
 Prof. Dr. Christoph Gröpl Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht, deutsches und europäisches Finanzund Steuerrecht Vorlesung Staatsrecht II (Grundrechte) 1 Freizügigkeit, Art. 11 GG 1. Schutzbereich
Prof. Dr. Christoph Gröpl Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht, deutsches und europäisches Finanzund Steuerrecht Vorlesung Staatsrecht II (Grundrechte) 1 Freizügigkeit, Art. 11 GG 1. Schutzbereich
printed by
 Diese Prüfung ist nur für Kandidaten nach Art. 41, Repetenten, und Kandidaten mit nicht beibringbaren Berufsschulnoten bestimmt. Zentralkommission für die Lehrabschlussprüfungen der kaufmännischen und
Diese Prüfung ist nur für Kandidaten nach Art. 41, Repetenten, und Kandidaten mit nicht beibringbaren Berufsschulnoten bestimmt. Zentralkommission für die Lehrabschlussprüfungen der kaufmännischen und
Schweiz in der Zwischenkriegszeit
 Geschichte Schweiz in der Zwischenkriegszeit Zusammenfassungen Prüfung Mittwoch, 18. Januar 2017 Wirtschaftliche Auswirkungen Majorzwahlverfahren Proporzwahlverfahren Einführung der Proporzwahl in CH Folgen
Geschichte Schweiz in der Zwischenkriegszeit Zusammenfassungen Prüfung Mittwoch, 18. Januar 2017 Wirtschaftliche Auswirkungen Majorzwahlverfahren Proporzwahlverfahren Einführung der Proporzwahl in CH Folgen
Öffentliches Verfahrensrecht
 Prof. Dr. Felix Uhlmann Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Rechtsetzungslehre ÖVR 6 Prof. Dr. Felix Uhlmann 1 Beschwerdeverfahren II (insb. Beschwerdeinstanzen) Prof. Dr. Felix Uhlmann 2
Prof. Dr. Felix Uhlmann Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Rechtsetzungslehre ÖVR 6 Prof. Dr. Felix Uhlmann 1 Beschwerdeverfahren II (insb. Beschwerdeinstanzen) Prof. Dr. Felix Uhlmann 2
Gliederungen des positiven Rechts
 Gliederungen des positiven Rechts I. Gliederung aufgrund der Normenhierarchie 1. Verfassung 2. Gesetz (im formellen Sinn) 3. Verordnung II. III. IV. Gliederung aufgrund der Hierarchie der Gemeinwesen 1.
Gliederungen des positiven Rechts I. Gliederung aufgrund der Normenhierarchie 1. Verfassung 2. Gesetz (im formellen Sinn) 3. Verordnung II. III. IV. Gliederung aufgrund der Hierarchie der Gemeinwesen 1.
Fall 5 (Marco Donatsch, 17./18. Oktober 2011)
 Fall 5 (Marco Donatsch, 17./18. Oktober 2011) Vorgehen bei der Fallbearbeitung: Analyse Sachverhalt Erfassung der Fragestellung Welche Rechtsfragen stellen sich? Erstellen einer Problemliste Lösung der
Fall 5 (Marco Donatsch, 17./18. Oktober 2011) Vorgehen bei der Fallbearbeitung: Analyse Sachverhalt Erfassung der Fragestellung Welche Rechtsfragen stellen sich? Erstellen einer Problemliste Lösung der
Einzelrichter Vito Valenti, Gerichtsschreiberin Madeleine Keel. A., Beschwerdeführer, gegen
 B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a
Prüfung Öffentliches Recht I, Herbstsemester Aufgabe A.1. Lösungs- und Korrekturhinweise. (14 Punkte)
 Prüfung Öffentliches Recht I, Herbstsemester 2014 Lösungs- und Korrekturhinweise Aufgabe A (20 Punkte) Aufgabe A.1 (14 Punkte) Die Glaubens- und Gewissensfreiheit vermittelt als Grundrecht (Freiheitsrecht)
Prüfung Öffentliches Recht I, Herbstsemester 2014 Lösungs- und Korrekturhinweise Aufgabe A (20 Punkte) Aufgabe A.1 (14 Punkte) Die Glaubens- und Gewissensfreiheit vermittelt als Grundrecht (Freiheitsrecht)
ejustice in der Schweiz Stand der Arbeiten beim Bund
 ejustice in der Schweiz Stand der Arbeiten beim Bund Agenda 1. ZertES-Totalrevision 2. elektronischer Rechtsverkehr 3. elektronische Akteneinsicht 2 Inhalt der ZertES-Totalrevision Botschaft wurde vom
ejustice in der Schweiz Stand der Arbeiten beim Bund Agenda 1. ZertES-Totalrevision 2. elektronischer Rechtsverkehr 3. elektronische Akteneinsicht 2 Inhalt der ZertES-Totalrevision Botschaft wurde vom
Übertragung der Zuständigkeit für Submissionsbeschwerden. an das Verwaltungsgericht; Änderung des Gesetzes über die Gerichtsorganisation (GO)
 KR.Nr. Übertragung der Zuständigkeit für Submissionsbeschwerden von der Schätzungskommission an das Verwaltungsgericht; Änderung des Gesetzes über die Gerichtsorganisation (GO) Botschaft und Entwurf des
KR.Nr. Übertragung der Zuständigkeit für Submissionsbeschwerden von der Schätzungskommission an das Verwaltungsgericht; Änderung des Gesetzes über die Gerichtsorganisation (GO) Botschaft und Entwurf des
Aufbau Verfassungsbeschwerde. Die Verfassungsbeschwerde hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist.
 Aufbau Verfassungsbeschwerde Die Verfassungsbeschwerde hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist. A. Zulässigkeit Die Zulässigkeitsvoraussetzungen der Verfassungsbeschwerde ergeben sich
Aufbau Verfassungsbeschwerde Die Verfassungsbeschwerde hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist. A. Zulässigkeit Die Zulässigkeitsvoraussetzungen der Verfassungsbeschwerde ergeben sich
Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik
 Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik Suchabfrage 02.0.207 Thema Keine Einschränkung Schlagworte Wettbewerb Akteure Genf, Luzern Prozesstypen Keine Einschränkung Datum 0.0.998-02.0.207 0.0.98-02.0.7
Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik Suchabfrage 02.0.207 Thema Keine Einschränkung Schlagworte Wettbewerb Akteure Genf, Luzern Prozesstypen Keine Einschränkung Datum 0.0.998-02.0.207 0.0.98-02.0.7
Allgemeines Verwaltungsrecht
 Dr. Sebastian Unger Allgemeines Verwaltungsrecht Sommersemester 2014 16. April 2014 Kontaktdaten: Dr. Sebastian Unger Büro: Raum 216 Telefon: 06221/54 74 52 Mail: unger@jura.uni-muenchen.de Sprechstunde:
Dr. Sebastian Unger Allgemeines Verwaltungsrecht Sommersemester 2014 16. April 2014 Kontaktdaten: Dr. Sebastian Unger Büro: Raum 216 Telefon: 06221/54 74 52 Mail: unger@jura.uni-muenchen.de Sprechstunde:
Beschlüsse der Bundesversammlung
 Beschlüsse der Bundesversammlung Bundesverfassung (Art. 140 Abs. 1 lit. a) Bundesgesetz (Art. 163 Abs. 1) (Art. 163 Abs. 1) Bundesbeschluss (Art. 163 Abs. 2) Ausnahme: dringlich (Art. 165) Regel: nicht
Beschlüsse der Bundesversammlung Bundesverfassung (Art. 140 Abs. 1 lit. a) Bundesgesetz (Art. 163 Abs. 1) (Art. 163 Abs. 1) Bundesbeschluss (Art. 163 Abs. 2) Ausnahme: dringlich (Art. 165) Regel: nicht
Observationen im Sozialversicherungsrecht
 Observationen im Sozialversicherungsrecht Voraussetzungen und Schranken Übersicht 1. Einleitung und Problemstellung 3. E-Art. 44a ATSG (Überwachung) 5. Schlussbetrachtung 1 1. Einleitung und Problemstellung
Observationen im Sozialversicherungsrecht Voraussetzungen und Schranken Übersicht 1. Einleitung und Problemstellung 3. E-Art. 44a ATSG (Überwachung) 5. Schlussbetrachtung 1 1. Einleitung und Problemstellung
ZPO Fallstricke und Chancen. Kongresshaus Zürich (1127.) 18. März 2014
 Kongresshaus Zürich (1127.) 18. März 2014 Knackpunkte im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren Dr. iur. Christoph Hurni I. Vorbemerkung Knackpunkte im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren? Konzentration
Kongresshaus Zürich (1127.) 18. März 2014 Knackpunkte im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren Dr. iur. Christoph Hurni I. Vorbemerkung Knackpunkte im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren? Konzentration
Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs in der Schweiz Stand der Arbeiten beim Bund
 Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs in der Schweiz Stand der Arbeiten beim Bund Wo steht die ZertES-Revision heute? Botschaft wurde vom Bundesrat am 15. Januar 2014 verabschiedet (vgl. BBl 2014
Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs in der Schweiz Stand der Arbeiten beim Bund Wo steht die ZertES-Revision heute? Botschaft wurde vom Bundesrat am 15. Januar 2014 verabschiedet (vgl. BBl 2014
Grundrechte Menschenrechte Verfassungsmässige Rechte
 Grundrechte Menschenrechte Verfassungsmässige Rechte Vorlesung vom 29. September 2016 BGK 29 I und III, 30 II Vorbereitung: Lektüre von Dokument 3 (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte) HS 2016 Staatsrecht
Grundrechte Menschenrechte Verfassungsmässige Rechte Vorlesung vom 29. September 2016 BGK 29 I und III, 30 II Vorbereitung: Lektüre von Dokument 3 (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte) HS 2016 Staatsrecht
Persönlicher und sachlicher Schutzbereich der Grundrechte
 Persönlicher und sachlicher Schutzbereich der Grundrechte Vorlesung vom 13.10.2016 BGK 30 V Vorbereitung: Lektüre von Dokument 5 (BGer 1C_312/2010 vom 8. Dezember 2010) HS 2016 Staatsrecht II - PD Patricia
Persönlicher und sachlicher Schutzbereich der Grundrechte Vorlesung vom 13.10.2016 BGK 30 V Vorbereitung: Lektüre von Dokument 5 (BGer 1C_312/2010 vom 8. Dezember 2010) HS 2016 Staatsrecht II - PD Patricia
Rechtswissenschaftliches Institut. Willkürverbot/Treu und Glauben
 Willkürverbot/Treu und Glauben Willkürverbot (Art. 9 BV) Sachlicher Schutzbereich Willkürverbot schützt vor willkürlichem Verhalten der Behörden, unabhängig vom betroffenen Lebensbereich oder Rechtsgebiet
Willkürverbot/Treu und Glauben Willkürverbot (Art. 9 BV) Sachlicher Schutzbereich Willkürverbot schützt vor willkürlichem Verhalten der Behörden, unabhängig vom betroffenen Lebensbereich oder Rechtsgebiet
Modul 55104: Staats- und Verfassungsrecht
 Modul 55104: Staats- und Verfassungsrecht Besprechung der Klausur aus dem SS 2014 Fragestellung: Prüfung von Grundrechtsverletzungen Fallfrage genau lesen! Keine Verfassungsbeschwerde, also nicht Zulässigkeit
Modul 55104: Staats- und Verfassungsrecht Besprechung der Klausur aus dem SS 2014 Fragestellung: Prüfung von Grundrechtsverletzungen Fallfrage genau lesen! Keine Verfassungsbeschwerde, also nicht Zulässigkeit
Die Rückerstattungsverfügung. Übungen im Öffentlichen Recht III (FS 2016) Übung vom 25./26. April 2016 Dr. David Hofstetter
 Die Rückerstattungsverfügung Übung vom 25./26. April 2016 Dr. David Hofstetter Eckpunkte des Sachverhalts Wirtschaftliche Unterstützung («Sozialhilfe») an A durch die Sozialbehörde der Stadt X zwischen
Die Rückerstattungsverfügung Übung vom 25./26. April 2016 Dr. David Hofstetter Eckpunkte des Sachverhalts Wirtschaftliche Unterstützung («Sozialhilfe») an A durch die Sozialbehörde der Stadt X zwischen
A Bundesgesetz über die Mitwirkung der politischen Parteien an der Meinungs- und Willensbildung des Volkes
 A Bundesgesetz über die Mitwirkung der politischen Parteien an der Meinungs- und Willensbildung des Volkes Entwurf vom Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestützt auf Artikel
A Bundesgesetz über die Mitwirkung der politischen Parteien an der Meinungs- und Willensbildung des Volkes Entwurf vom Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestützt auf Artikel
Vertrag. haben Folgendes vereinbart: vom 5. März 2010
 . Vertrag vom 5. März 00 über die Mitwirkung der Kantonsparlamente bei der Ausarbeitung, der Ratifizierung, dem Vollzug und der Änderung von interkantonalen Verträgen und von Verträgen der Kantone mit
. Vertrag vom 5. März 00 über die Mitwirkung der Kantonsparlamente bei der Ausarbeitung, der Ratifizierung, dem Vollzug und der Änderung von interkantonalen Verträgen und von Verträgen der Kantone mit
Konversatorium zum Grundkurs Öffentliches Recht II Grundrechte Fall 5: Obligatorische Zivilehe
 Sommersemester 2008 Konversatorium zum Grundkurs Öffentliches Recht II Grundrechte Fall 5: Obligatorische Zivilehe I. Materielle Prüfung Verletzung von Art. 4 I, II GG? 1. Schutzbereich betroffen? sachlich:
Sommersemester 2008 Konversatorium zum Grundkurs Öffentliches Recht II Grundrechte Fall 5: Obligatorische Zivilehe I. Materielle Prüfung Verletzung von Art. 4 I, II GG? 1. Schutzbereich betroffen? sachlich:
